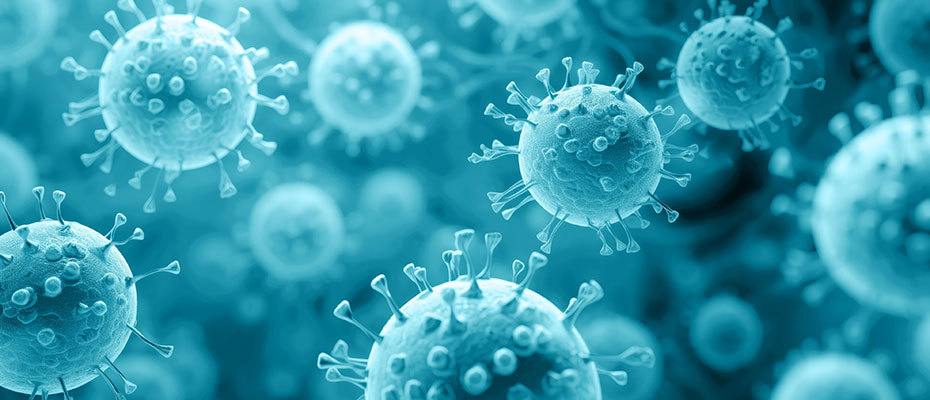Mit dieser Frage befasste sich das Verwaltungsgericht Regensburg (VG) im unten vermerkten rechtskräftigen Urteil vom 29.11.2022.
Ihm lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der verbeamtete Kläger (Kl.) ist seit 1.4.2011 als Hygienekontrolleur/-obersekretär im Gesundheitsamt des Landratsamtes tätig. Dort war er u.a. für den Bereich Infektionsschutz und Krankenhaushygiene zuständig. Nach Angaben des Kl. wurde sein Aufgabenbereich überwiegend im Innendienst, aber – schwankend zwischen ca. 15 und 40 % – auch im Außendienst, vor allem im Bereich der Krankenhaushygiene, wahrgenommen. Nach Beginn der Corona- Pandemie in der Bundesrepublik Deutschland ab Februar 2020 bezogen sich seine Aufgaben nahezu ausschließlich auf diese. Der Kl. hat u.a. ausgeführt, während dieser Zeit seien sehr viele Besprechungen, also persönliche Kontakte, notwendig gewesen, vereinzelt auch mit externen Personen, wie Hausärzten, Kliniken und dem Bayerischen Roten Kreuz. Am 12.3.2020 wurden in ganz Deutschland Großveranstaltungen untersagt. Ab 14.3.2020 waren in B. die Kindertagesstätten und Schulen geschlossen, am 16.3.2020 wurden Veranstaltungen und Versammlungen untersagt sowie die Gastronomie und der Großteil des Einzelhandels geschlossen. In diesem Zeitraum erfolgten die Tests durch das Gesundheitsamt … hauptsächlich durch mobile Testteams. Deren Schaltzentrale war nach klägerischem Vortrag direkt neben dem Büro des Kl. gelegen. Nach Angaben des Kl. wurden vereinzelt auch vor Ort – im Außenbereich vor dem Gesundheitsamt – Testabstriche abgenommen. Der Kl. war assistierend tätig, Testabstriche wurden aber nur von medizinischem Fachpersonal durchgeführt. Nach eigenen Angaben war der Kl. an einzelnen Tagen auch mit dem Handling der Teströhrchen betraut. Diese nahm er nach den Touren wieder entgegen und pflegte sie elektronisch ein. Ab 20.3.2020 wurde der Kl. in diesem Bereich von einem Mitarbeiter abgelöst.
Am 28.3.2020 wurden dem Kl. und seiner Ehefrau die positiven Ergebnisse einer SARS-COV-2/Covid-19-Infektion mitgeteilt. Der Zustand des Kl. verschlimmerte sich schnell, er musste vom 1.4.2020 bis 13.4.2020 in stationäre Behandlung auf die Isolierstation im Krankenhaus. Es wurde eine Lungenentzündung diagnostiziert. Am 11.5.2020 nahm er den Dienst wieder auf. Auf Nachfrage des Gerichts hat der Kl. acht Personen konkret benannt, welche im gleichen Zeitraum positiv getestet worden seien. Der Kl. beantragte am 21.4.2020 die Anerkennung seiner Infektion und Erkrankung an SARS-COV-2/COVID-19 als Dienstunfall, was der Beklagte (Bekl.) ablehnte. Im Widerspruchsverfahren unterlag der Kläger noch, im Klageverfahren hatte er hingegen Erfolg. Dem Urteil des VG entnehmen wir auszugsweise:
1. Nichtvorliegen eines Dienstunfalls gem. Art. 46 Abs. 1 Satz 1 BayBeamtVG
„Die Infektion des Kl. mit SARS-CoV-2 erfüllt nicht die Voraussetzungen des Art. 46 Abs. 1 Satz 1 BayBeamtVG.
Danach ist ein Dienstunfall ein auf äußerer Einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, einen Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Ausübung oder infolge des Dienstes eingetreten ist. Nach ständiger Rechtsprechung kann auch eine Infektionserkrankung ein solches Ereignis sein (vgl. BVerwG 28.1.1993 – 2 C 22.90).
Entgegen der Ansicht des Bekl. liegt ein äußeres Ereignis vor und es ist bei Art. 46 Abs. 1 Satz 1BayBeamtVG unerheblich, dass es sich bei SARS-CoV-2/ COVID-19 um eine Pandemie und damit eine allgemeine Gefahr handelt. Es fehlt allerdings an der örtlichen und zeitlichen Bestimmbarkeit.
Das Tatbestandsmerkmal ,äußere Einwirkung‘ dient in erster Linie zur Abgrenzung von Vorgängen im Inneren des menschlichen Körpers. Es soll Unfallereignisse und Köperschädigungen ausschließen, die auf eine in körperlicher oder seelischer Hinsicht besondere Veranlagung des Beamten oder auf willentliches (vorsätzliches) Verhalten des Beamten zurückgehen. Dabei wird die Abgrenzung negativ vorgenommen: Ist eine ,innere‘ Einwirkung nicht erkennbar, liegt eine äußere Einwirkung vor. Dabei kann eine äußere Einwirkung auch eine eigene Handlung des Beamten sein (vgl. zum Ganzen Stegmüller/Schmalhoer/Bauer/Kazmaier Beamtenversorgungsrecht, Stand: Feb. 2020, § 31 Rn. 21).
Eine Ansteckung mit SARS-CoV-2/COVID-19 erfolgt nach derzeitigem Wissensstand entweder als Tröpfcheninfektion oder als Schmierinfektion, dabei stellen beide Übertragungswege eine ,äußere Einwirkung‘ im Sinne des Dienstunfallrechts dar (vgl. hierzu auch Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, WD 6 – 3000 – 005/21, S. 10). Dabei ändert die Abhängigkeit der Schwere einer entwickelten Erkrankung von der körpereigenen Veranlagung nichts. Entgegen der Ansicht des Bekl. kommt es bei dem Tatbestandsmerkmal der äußeren Einwirkung nicht darauf an, ob es sich um ein alltägliches Ereignis handelt. Im Rahmen der äußeren Einwirkung erfolgt keine weitergehende Wertung, es kommt schlicht darauf an, ob das Ereignis von ,innen‘ oder von ,außen‘ wirkt. Die Auf- bzw. Einnahme – so schon der Wortsinn – auch kleinster Teilchen erfolgt ,von außen‘ und nicht ,von innen‘ (vgl. Günther/Fischer VBlNW 08/2020, 309 ff., unter II. 2.).
Für die Anerkennung als Dienstunfall ist es unerheblich, ob es sich bei der Erkrankung um die Verwirklichung des allgemeinen Lebensrisikos handelt. Denn der Begriff des Dienstunfalls gem. Art. 46 1 BayBeamtVG bzw. § 1 BeamtVG setzt nicht voraus, dass der Beamte bei seiner Tätigkeit einer höheren Gefährdung als die übrige Bevölkerung ausgesetzt ist oder sich in dem Körperschaden eine der konkreten dienstlichen Verrichtung innewohnende typische Gefahr realisiert hat (vgl. BVerwG NVwZ 2010, 708).
Der Infektion des Kl. mit SARS-CoV-2 liegt allerdings kein örtlich und zeitlich hinreichend bestimmbares Ereignis zugrunde. Es kann kein eindeutiger Ansteckungszeitpunkt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bestimmt werden.
Durch das Erfordernis der örtlichen und zeitlichen Bestimmbarkeit wird zum einen der Schutzbereich der Dienstunfallfürsorge festgelegt. Zum anderen dient es der Begrenzung des Risikos des Dienstherrn. Dieser soll nur für Schadensereignisse haften, die einem Nachweis zuganglich sind. Erst die eindeutige Bestimmung des Ereignisses ermöglicht es, sicher festzustellen, ob und inwieweit Veränderungen des Gesundheitszustandes des Beamten auf einen Dienstunfall zurückzuführen sind und von der Dienstunfallfürsorge nach Art. 45 ff. BayBeamtVG umfasst werden. Deshalb müssen die Angaben zu den Umständen des konkreten Ereignisses in zeitlicher und örtlicher Hinsicht in ihrer Gesamtheit so bestimmt sein, dass es Konturen erhält, auf Grund derer es von anderen Geschehnissen eindeutig abgegrenzt werden kann. Jede Verwechslung mit einem anderen Ereignis muss ausgeschlossen sein. Daraus folgt nach der Rechtsprechung des BVerwG, dass sich genau bestimmen lassen muss, wann und wo sich das Ereignis abgespielt hat. Ort und Zeitpunkt müssen feststehen. Für die zeitliche Bestimmbarkeit genügt es nicht, dass sich ein über mehrere Tage erstreckender Zeitraum nach Anfangs- und Schlusstag eingrenzen lässt. Demnach reicht es bei Infektionen nicht aus, dass die Inkubationszeit und der Ort, an dem sich der Beamte während dieser Zeit aufgehalten hat, bekannt sind, um die Infektionserkrankung als einen Unfall zu bewerten. Es ist daher anzuerkennen, dass sich der Zeitpunkt der Ansteckung mit einer Infektionskrankheit fast ausnahmslos nicht mit der gem. Art. 46Abs. 1 Satz 1 BayBeamtVG bzw. § 31Abs. 1 Satz 1 BeamtVG erforderlichen Genauigkeit feststellen lässt (vgl. BVerwG 19.1.2006 – 2 4 B 46.05, NVwZ 2010, 708; Stegmüller/Schmalhoer/Bauer/Kazmaier Beamtenversorgungsrecht, Stand: Februar 2020, § 31 Rn. 35).Nach ständiger Rechtsprechung des BVerwG gelten im Dienstunfallrecht grundsätzlich die allgemeinen Beweisgrundsätze, dabei ist für das Vorliegen eines Dienstunfalls grundsätzlich der volle Beweis zu erbringen, d.h. er muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststehen (vgl. z.B. BVerwG NJW1982, 1893).
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze kann der Kl. den hinreichenden Nachweis einer örtlich und zeitlich bestimmbaren Infektion nicht führen.
Nach dem epidemiologischen Steckbrief auf dem Stand des 26.11.2021 (abrufbar unter RKI – Coronavirus SARS–CoV-2 – Epidemiologischer Steckbrief zu SARS– CoV-2 und COVID-19) zu SARS-CoV-2/COVID-19 beträgt die Inkubationszeit bis zu 14 Tagen, die mittlere Inkubationszeit betragt 5,8 Tage und die 95 %-Perzentile wird mit 11,7 Tagen angegeben. Der Kl. geht davon aus, dass er sich im Rahmen einer Besprechung mit seiner Kollegin Frau A mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an ihr angesteckt hat. Er gibt an, am 23.3.2020 zwischen 10:00 und 12:00 Uhr ein ca. 15-minütiges Gespräch mit ihr geführt zu haben. Am Abend desselben Tages oder vielleicht auch noch während des Dienstes habe Frau A sodann Symptome gehabt. Der Kl. trägt auch vor, sich mit seiner Familie – auch wegen ihres beruflichen Hintergrundes – weitgehend isoliert zu haben. Er selbst sei, da er vom Land komme, allein mit dem Auto in die Dienststelle gefahren. Auch habe er im März 2020 im privaten Bereich keinen Kontakt über 15 Minuten gehabt oder sei nicht länger in einem Innenraum mit anderen Personen gewesen. Die Kinder wären nur zuhause gewesen und hätten auch keine Freunde getroffen. Ein ca. im Mai oder Juni 2020 durchgeführter Antikörpertest habe ergeben, dass die Kinder ebenfalls, aber symptomlos an COVID-19 erkrankt waren. Meistens sei seine Frau einkaufen gewesen, da er oft wegen seiner langen Arbeitszeit zeitlich nicht mehr einkaufen habe können. Seine Frau sei Anfang März 2020 von ihrem Arbeitgeber nach Hause geschickt worden. Sie sei als Krankenschwester auf der orthopädischen Station beschäftigt gewesen. Wegen Absehbarkeit der Pandemie sei die Station jedoch geschlossen und das Personal, so auch die Ehefrau des Kl., nicht mehr benötigt worden. Die Station sei umstrukturiert worden, um COVID-19-Patienten zu beherbergen. Der Kl. konnte in der mündlichen Verhandlung mit Sicherheit angeben, dass das 14 Tage vor seiner Infektion gewesen sei. Er habe sich das damals zusammengeschrieben und könne sich daher genau erinnern. Die Ehefrau habe zum gleichen Zeitpunkt Symptome gezeigt und sei zeitgleich mit dem Kl. positiv getestet worden.
Mit diesem Vortrag hat der Kl. keinen bestimmten Zeitpunkt für die Infektion nachgewiesen. Im März 2020 ist davon auszugehen, dass der sog. Wildtyp des SARS-CoV-2 vorlag, dessen Ansteckungsgefahr verglichen mit der 2022 vorherrschenden Variante ,omicron‘ als geringer einzustufen ist. Die Möglichkeit einer Ansteckung von seiner Frau ist dennoch gegeben. Selbst bei gewissenhafter Vorsicht und Isolation ist eine Ansteckung im privaten Umfeld grundsätzlich möglich. Im Übrigen trägt der Kl. selbst vor, es seien zahlreiche Besprechungen notwendig gewesen, gerade auch im Rahmen des Bürgertelefons. Dabei wurden noch keine Masken getragen, da es noch keine allgemeine Maskenempfehlung gab. Eine solche hat das RKI – so gerichtsbekannt und vorgetragen – erst ab April 2020 ausgesprochen. Also ist eine Ansteckung in diesem anderen – dennoch dienstlichen – Rahmen ebenfalls nicht auszuschließen. Es steht also nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fest, dass sich der Kl. am 23.3.2020 zwischen 10:00 und 12:00 an Frau A … angesteckt hat.“
[…]Den vollständigen Beitrag entnehmen Sie der Fundstelle Bayern Heft 4/2024, Rn. 39.