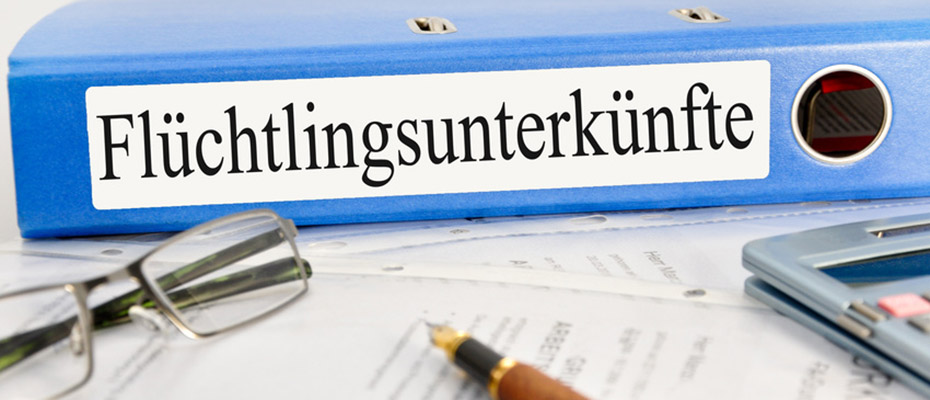Im Rahmen einer Popularklage hatte der Bayerische Verfassungsgerichtshof (VerfGH) über die Verfassungsmäßigkeit der seit dem 1.1.2013 geltenden Vorschrift des Art. 46 Abs. 4 BayBO zu befinden, die den Einsatz und Betrieb von Rauchwarnmeldern in Wohnungen regelt.
Danach müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, die zu Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen solchen Warnmelder haben; die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft obliegt den unmittelbaren Besitzern, wenn der Eigentümer die Verpflichtung nicht selbst übernimmt. Die Antragsteller hielten diese Bestimmungen für verfassungswidrig, da sie das Eigentumsrecht (Art. 103 BV), die Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 106 Abs. 3 BV) und den Gleichheitsgrundsatz (Art. 118 Abs. 1 BV) verletzten. Eine Evaluation der Nützlichkeit und Auswirkungen von Rauchwarnmeldern habe nicht stattgefunden; diese seien jedoch erwiesenermaßen ungeeignet, Leben zu retten, und führten stattdessen zu zahlreichen Risiken und ungerechtfertigten Belastungen für die Inhaber der Wohnungen. Der VerfGH hielt die Popularklage in seiner unten vermerkten Entscheidung vom 26.10.2023 aufgrund der nachfolgenden Erwägungen für unbegründet.
Ob und inwieweit es im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens einer eigenen Tatsachenermittlung bedarf, ist eine autonome Entscheidung der Abgeordneten
„Die angegriffene Norm ist verfassungsmäßig zustande gekommen. Art. 46 Abs. 4 BayBO wurde in einem ordnungsgemäßen Gesetzgebungsverfahren…vom Bayerischen Landtag in Zweiter Lesung einstimmig beschlossen … Auch soweit die Antragsteller beanstanden, dass der Gesetzgeber seine Verpflichtung, die dem Gesetzesvorhaben zugrunde liegenden Tatsachen zu ermitteln und zu bewerten, verletzt habe, ist die prozedurale Gestaltung der Gesetzgebung verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Es ist die autonome Entscheidung der Abgeordneten, welche Informationen und welchen Beratungs- und Diskussionsbedarf sie insoweit für notwendig erachten; diese autonome Entscheidung ist verfassungsgerichtlich grundsätzlich nicht überprüfbar (VerfGH vom 29.9.2005 VerfGHE 58, 212/234 ff.; vom 23.11.2016 VerfGHE 69, 324 Rn. 72). Auch muss der Abwägungsprozess im Landtag nicht im Einzelnen nachgewiesen werden (VerfGHE 69, 324 Rn. 72). Es liegt hier auch kein Fall vor, in dem für den Gesetzgeber und das von ihm anzuwendende Verfahren ausnahmsweise besondere Anforderungen bezüglich der Informationsbeschaffung sowie der Intensität und Tiefe der parlamentarischen Beratung bestünden … Davon zu unterscheiden ist die – von den Antragstellern in den Mittelpunkt gerückte – Frage, ob eine unzureichende Sachverhaltsermittlung oder Prognose aus materiellen verfassungsrechtlichen Erwägungen zur Verfassungswidrigkeit einer Norm führen kann …“
Die Sozialbindung des Eigentums kann gesetzliche Verpflichtungen des Eigentümers wie auch des Mieters einer Wohnung rechtfertigen
„Der Schutzbereich des Art. 103 BV ist durch die angegriffene Vorschrift tangiert. Durch Art. 103 BV wird das Eigentum in allen seinen Ausstrahlungen gewährleistet. Geschützt ist insoweit jede bestehende privatrechtliche vermögenswerte Rechtsposition (VerfGH vom 23.7.1996 VerfGHE 49, 111/116 f.). Dementsprechend gilt der Eigentumsschutz grundsätzlich auch für vertraglich vermittelte Nutzungs- und Besitzrechte. Das aus dem Mietvertrag folgende Besitzrecht eines Mieters genießt die Gewährleistung des Art. 103 BV … Sowohl Eigentümer als auch Mieter einer Wohnung sind daher in ihrem Grundrechtsschutz durch die gem. Art. 46 Abs. 4 BayBO begründeten Verpflichtungen berührt. Dem Grundrecht sind die Bindungen aus Art. 103 Abs. 2 und Art. 158 Satz 1 BV immanent. Eine verfassungswidrige Eigentumsbeschränkung liegt nicht vor, wenn der Normgeber in Ausübung seiner Befugnis, die Eigentumsordnung im Dienst des Gemeinwohls festzulegen, den Inhalt des Eigentums allgemeinverbindlich abgrenzt.
Die angegriffene Regelung des Art. 46 Abs. 4 BayBO stellt jedenfalls sowohl für Eigentümer als auch für unmittelbare Besitzer von Wohnungen eine durch die Sozialbindung des Eigentums gerechtfertigte Inhalts- und Schrankenbestimmung gemäß Art. 103 Abs. 2, Art. 158 Satz 1 BV dar.“
Mit der Rauchwarnmelderpflicht verfolgt der Gesetzgeber einen verfassungsrechtlich legitimen Zweck
„Die in Art. 46 Abs. 4 BayBO für Eigentümer und unmittelbare Besitzer normierten Verpflichtungen dienen einem legitimen Ziel. In der Begründung des Änderungsantrags, mit dem die angegriffene Norm in das Gesetzesvorhaben eingebracht worden ist, wird ausgeführt, dass die gesetzliche Verpflichtung ausschließlich dem Schutz von Leib und Leben der sich in der Wohnung aufhaltenden Menschen dienen solle (LT-Drs. 16/13736). Jährlich würden bei Wohnungsbränden Menschen an den Folgen von Verbrennungen sterben oder im Brandrauch ersticken. Weiterhin bezieht sich die Begründung des Änderungsantrags nicht nur auf die in der überwiegenden Anzahl der Bundesländer bereits vorgeschriebene gesetzliche Verpflichtung zur Installation und Wartung von Rauchwarnmeldern, sondern explizit auch auf den Beschluss des Landtags vom 18.4.2012, mit dem dieser die Initiative von Feuerwehren für die Anbringung von Rauchmeldern in Wohnungen begrüßt und sich für eine Rauchwarnmelderpflicht in allen Neubauten und mit Übergangsfrist auch in allen Altbauten ausgesprochen hatte (LT-Drs. 16/12234). Dem Landtagsbeschluss vom 18.4.2012 war eine ausführliche Debatte im Plenum vorausgegangen (Plenarprotokoll 16/99 S. 9104 bis 9131), ihm lag ein Positionspapier ,Rauchmelder retten Leben!‘ … zugrunde …, das am 13.4.2012 an den zuständigen Staatsminister des Innern übergeben worden war. In dem Positionspapier wird (unter Hinweis auf gesetzliche Regelungen in neun anderen Bundesländern und die bisherigen Umsetzungserfahrungen) eine Gesetzesinitiative zur Änderung der Bayerischen Bauordnung zur Einführung einer ,Rauchwarnmelderpflicht‘ gefordert.
Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber bei der Einführung der Rauchwarnmelderpflicht den Schutz von Leben und Gesundheit des in der Wohnung selbst wohnenden Eigentümers bzw. des unmittelbaren Besitzers der Wohnung sowie aller anderen dort dauerhaft wohnenden bzw. sich vorübergehend aufhaltenden weiteren Personen und zudem bei Mehrpersonenobjekten auch den Schutz der im gleichen Objekt wohnenden oder anwesenden sonstigen Personen beabsichtigt hat…Der Gesetzgeber verfolgt also einen legitimen Zweck.
Der Betrieb von Rauchwarnmeldern stellt eine zur Gefahrenabwehr geeignete Maßnahme dar
„Der Gesetzgeber durfte auch davon ausgehen, dass die durch die angegriffene Regelung geschaffenen Verpflichtungen zur Installation und Wartung von Rauchwarnmeldern dazu beitragen können, das mit ihnen verfolgte Ziel zu erreichen und den ihnen zugedachten Zweck zu erfüllen…Angesichts der eingeschränkten Sinneswahrnehmung im Schlaf liegt es auf der Hand und bedarf keiner weiteren Begründung, dass ein durch Brandrauch ausgelöstes akustisches Signal dazu beitragen kann, gefährdete Personen frühzeitig zu alarmieren, damit sie sich in Sicherheit bringen bzw. Hilfe anfordern können. Es ist auch nicht zu beanstanden, wenn der Gesetzgeber sich insoweit insbesondere auf die Einschätzungen von Institutionen stützt, die kraft der ihnen zugewiesenen Aufgaben besonders fachkundig sind: Den Feuerwehren ist nach Art. 4 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes der abwehrende Brandschutz als gesetzliche Aufgabe zugewiesen; ihre Fachkunde bezüglich des Nutzens von Rauchwarnmeldern in Wohnungen, wie sie in den Fachinformationen der Feuerwehren dargestellt werden, steht außer Zweifel. Soweit die Antragsteller generell behaupten, Rauchwarnmelder seien nicht tauglich, um Todesfälle und Verletzungen durch Feuer und Rauch zu verhindern, also die Eignung der Geräte an sich infrage stellen, und zur Begründung auf journalistische Darstellungen verweisen sowie die fehlenden Beweise und statistischen Belege für einen Zusammenhang bemängeln, ist im Übrigen auf den grundsätzlich weiten Beurteilungs- und Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers zu verweisen.
Der Gesetzgeber ist verfassungsrechtlich nicht gehalten, vor dem Erlass einer gesetzlichen Regelung statistische Erhebungen zu deren voraussichtlicher Wirksamkeit einzuholen. Es ist auch insoweit nicht zu beanstanden, wenn der Gesetzgeber sich auf Einschätzungen von Fachinstitutionen stützt. So wird in dem Positionspapier bayerischer Feuerwehrverbände und der AGBF1) Bayern auf die sich aus der Brandschadenstatistik Hamburgs ergebende deutliche Reduzierung der Zahl der Brandtoten seit der dortigen Einführung der Rauchwarnmelderpflicht im Jahr 2006 Bezug genommen. Weiterhin wird darin darauf verwiesen, dass sich im Ausland in Ländern mit einer Rauchwarnmelderpflicht bei einer Ausstattungsquote von ca. 80 % die Opferzahlen etwa halbiert hätten. Darauf durfte sich der Gesetzgeber auch ohne das Vorliegen repräsentativer Statistiken oder etwaiger Evaluierungen in anderen Bundesländern aufgrund seiner Einschätzungsprärogative stützen.“
[…]Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Entscheidung vom 26.10.2023 – 6-VII-22
Den vollständigen Beitrag lesen Sie in Fundstelle Bayern 9/2024, Rn. 95.