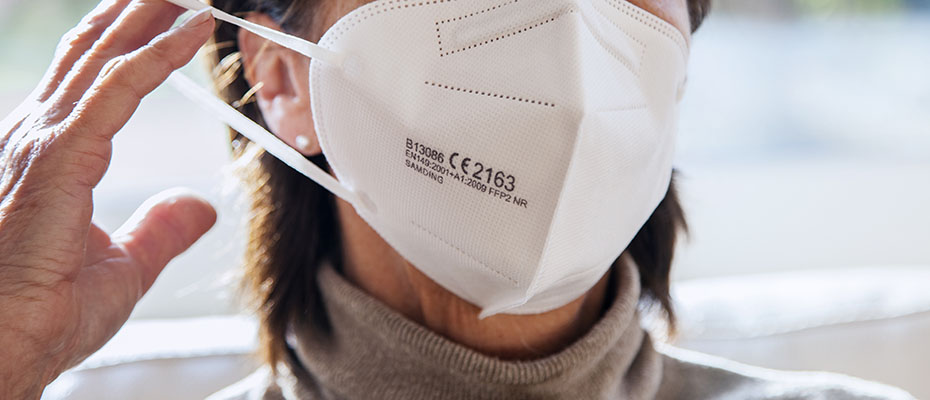Durch Urteil vom 19. Dezember 20231 hat das Bundesverwaltungsgericht neuen juristischen Wind in die „Kreuzerlass-Debatte“ gebracht. Das Aufhängen der Kreuze wurzelt in der bayerischen Regelung § 28 AGO, nach welchem im Eingangsbereich eines jeden bayerischen Dienstgebäudes als „Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns“ ein Kreuz gut sichtbar anzubringen ist. Dagegen hatten unter anderem der Bund für Geistesfreiheit München und der Bund für Geistesfreiheit Bayern geklagt, die beide als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisiert sind.
Nachdem die Leistungsklage auf Entfernung der Kreuze erstinstanzlich bereits keinen Erfolg hatte, wies auch der BayVGH die Klage als zulässig, aber unbegründet ab2. Das Gericht sah zwar die objektiv-rechtliche Pflicht des Staates zu weltanschaulich-religiöser Neutralität als verletzt an, verneinte aber einen Eingriff in Art. 4 GG und Art. 3 Abs. 3 GG3. Auch die Revision vor dem BVerwG war aus Klägersicht nicht von Erfolg gekrönt.
Das letzte Wort dürfte in diesem Fall allerdings noch nicht gesprochen sein, da der Bund für Geistesfreiheit München angekündigt hat, Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe einzulegen. Der bayerische Kreuzerlass war bereits Gegenstand zahlreicher Aufsätze und anderer Stellungnahmen4. Dieser Beitrag nimmt daher auch nicht zu allen Rechtsproblemen der Thematik Stellung.
Auf die (durchaus interessanten) prozessualen Besonderheiten des Falles und die konkreten Grundrechtsprüfungen soll nicht eingegangen werden. Stattdessen soll der Fokus auf den Neutralitätsgrundsatz gelegt werden. In der Handhabung dieses Grundsatzes weisen die Entscheidungen des BayVGH und des BVerwG einige interessante Unterschiede auf. Der BayVGH überprüfte die Verletzung des Neutralitätsgebots streng getrennt von Grundrechtsfragen. Er führte aus, dass die Pflicht des Staates zu weltanschaulich-religiöser Neutralität ein objektiv-rechtliches Verfassungsprinzip sei, aus dem keine subjektiven Rechte des Klägers erwachsen5. Im Gegensatz dazu verknüpft das BVerwG das Diskriminierungsverbot aus Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG mit dem Neutralitätsgrundsatz. Konkret heißt es, dass Art. 3 Abs. 3 GG „im Lichte des Grundsatzes weltanschaulich- religiöser Neutralität“ ausgelegt wird6. Dieses Vorgehen deutet möglicherweise auf eine subjektivrechtliche Aufhängung des Neutralitätsprinzips hin7. Abseits der unterschiedlichen dogmatischen Anknüpfung des Neutralitätsgebotes gelangen beide Gerichte auch zu unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich der Verletzung dieses Grundsatzes. Während der BayVGH hier noch eine Verletzung bejahte, wird ein derartiger Verstoß vom BVerwG nicht angenommen. Diese Disparität beider Entscheidungen bietet Anlass, sich über die dogmatische Verankerung (dazu 1.), die rechtlichen Schlussfolgerungen (dazu 2.) und die inhaltliche Reichweite (dazu 3.) des Neutralitätsprinzips Gedanken zu machen. Dazu zählt insbesondere auch die Frage, ob das Neutralitätsprinzip im Sinne des BayVGH nur ein objektives Prinzip darstellt oder ob aus ihm auch eine subjektive Rechtsposition erwächst. Innerhalb der inhaltlichen Reichweite wird zu untersuchen sein, ob der bayerische Kreuzerlass gegen den Neutralitätsgrundsatz verstößt.
1. Dogmatische Verankerung und Wirkung des Neutralitätsgebotes
Neutralität findet im Grundgesetz keine positivrechtliche Verankerung, sondern ergibt sich nach der ständigen Rechtsprechung des BVerfG aus der Gesamtschau mehrerer Verfassungsbestimmungen8.
Genau genommen sind es drei Begründungsstränge, die das Neutralitätsgebot9 konstituieren: Die grundgesetzlichen Diskriminierungsverbote (Art. 3 Abs. 3, 33 Abs. 3 GG, Art. 140 GG i. V. m. Art. 136 Abs. 1 und 4 WRV), die Religionsfreiheit (Art. 4 GG) und das Verbot einer Staatskirche (Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 1 WRV)10. Diese Begründungstrias erscheint durchaus logisch, wirft aber gewichtige Fragen hinsichtlich der Anwendung des Neutralitätsgebotes auf. Legt man den Fokus eher auf den freiheitsrechtlichen Aspekt dieses Grundsatzes, wie etwa die Kruzifix-Entscheidung des BVerfG vermuten lässt11? Sollen im Sinne des BVerwG gleichheitsrechtliche Erwägungen den Anknüpfungspunkt für staatliche Neutralität bilden12? Oder betont man im Klang des BayVGH eher die objektiv-rechtliche Wirkung des Neutralitätsgebotes13? Im engen Zusammenhang mit der dogmatischen Herleitung steht schließlich die Frage, ob der Grundsatz staatlicher Neutralität eine eigenständige Größe bildet oder lediglich ein Argument innerhalb grundrechtlicher Abwägungsentscheidungen darstellt14.
Klarheit kann hier ein Blick auf den Inhalt des Neutralitätsprinzips bringen. Neutralität heißt kurz gesagt, dass der Staat zu Fragen von Religion und Weltanschauung keine eigene Position bezieht15. Er ist keine Partei des weltanschaulichen Diskurses mehr16. Ihm ist es deshalb verwehrt, bestimmte Bekenntnisse zu privilegieren und Andersgläubige auszugrenzen17. Der neutrale Staat ist von einer Offenheit gegenüber der Vielfalt weltanschaulich- religiöser Überzeugungen geprägt18. Unzulässig ist damit eine gezielte Beeinflussung im Dienste einer bestimmten Religion oder Weltanschauung sowie die (konkludente oder explizite) Identifizierung mit einer bestimmten Religion19. Neutralität ist also in erster Linie eine Eigenschaftsbeschreibung des Staates sowie ein an den Staat adressierter Imperativ20. Als Eigenschaftsbeschreibung trifft Neutralität im Ausganspunkt noch keine Aussage über eine konkrete Rechtsposition des Bürgers, sondern lediglich über die Charakteristika des säkularen Staates. Das scheint für die objektiv-rechtliche Aufhängung des BayVGH zu sprechen21. Für diese Sichtweise lässt sich auch die Begründung des Neutralitätsprinzips anhand von Art. 137 Abs. 1 WRV anführen. Die Trennung von Staat und Kirche trifft eine (objektive) Aussage darüber, dass – in den Worten Luthers – geistliches und weltliches Regiment separiert sind.
Diese Trennung ist konstituierendes Merkmal moderner Staatlichkeit22.
Art. 137 Abs. 1 WRV begründet jedoch keinen justiziablen Anspruch des Bürgers auf Trennung von Staat und Kirche.
Säkularität und Neutralität sind jeweils Substantive, die ihre Wortwurzel von einem Adjektiv – und somit einer Eigenschaftsbeschreibung – ableiten. Das dient der Charakterisierung und der Zustandsbeschreibung des Staates.
An der objektiv-rechtlichen Wirkweise des Neutralitätsprinzips vermag auch dessen dogmatische Herleitung über Art. 4 GG und Art. 3 Abs. 3 GG nichts zu ändern. Grundrechte haben nicht nur die Aufgabe, subjektive und einklagbare Freiheits- und Abwehrrechte gegen den Staat zu garantieren (liberale Grundrechtstheorie).
Sie können auch zusätzlich als objektiv-rechtliche Normen ihre Wirkung auf die gesamte Rechtsordnung entfalten (Werttheorie der Grundrechte)23. Nach dieser Lesart konstituieren Grundrechte die grundlegenden Gemeinschaftswerte im Sinne eines Werte- und Kultursystems24. Genau diese objektivrechtliche Dimension der Grundrechte liegt auch dem Neutralitätsgebot zugrunde25. Art. 4 GG transportiert neben einem Abwehranspruch der Bürger auch die allgemeine (objektive) Aussage, dass sich der Staat zum Schutz jeder Religion und Weltanschauung verpflichtet. Ähnliches gilt für Art. 3 Abs. 3 GG26: Das spezielle Gleichheitsrecht schützt einerseits das Individuum vor Benachteiligung aufgrund seines Glaubens oder seiner religiösen Anschauung. Anderseits transportiert die Verfassung dadurch die allgemeine Aussage, dass es sich zur Gleichbehandlung jedweder Religion und Weltanschauung verpflichtet und den Genuss staatsbürgerlicher Rechte nicht an das religiöse Bekenntnis knüpft (Art. 136 Abs. 2 WRV). Gleichbehandlung wird dadurch zum grundlegenden Gemeinschaftswert. Somit ist es in erster Linie die objektivrechtliche Wirkung der Religionsfreiheit und der speziellen Gleichheitsrechte, die das Neutralitätsgebot gemeinsam mit Art. 137 Abs. 1 WRV dogmatisch konstituiert.
Dem BayVGH ist folglich darin zuzustimmen, dass das Neutralitätsgebot im Ausgangspunkt ein rein objektiv-rechtliches Verfassungsprinzip darstellt27.
2. Rechtliche Folgerungen aus dem Neutralitätsgebot
Die dogmatische Einordnung per se trifft noch keine normative Aussage über die juristische Wirkungsweise des Neutralitätsgrundsatzes.
Zum Teil wird vertreten, dass das Neutralitätsgebot allein ein Argument im Rahmen der grundrechtlichen Abwägung, nicht aber eine „außerhalb der Abwägung stehende Größe“ sei28. Dieser Auffassung scheint sich das BVerwG zuzuneigen, indem es Art. 3 Abs. 3 GG im Lichte des Neutralitätsgrundsatzes auslegt29. Noch deutlicher wird es, wenn das Gericht eine Funktionsbeschreibung des Neutralitätsgebotes vornimmt: Der Grundsatz weltanschaulich-religiöser Neutralität verstärke und ergänze subjektiv-rechtliche Grundrechtsgewährleistungen30.
Die Grundrechte (hier konkret Art. 3 Abs. 3 GG) bilden demnach den Ausgangspunkt rechtlicher Argumentation und werden durch das Neutralitätsgebot lediglich flankiert.
Das vorzugswürdigere Vorgehen besteht indes darin, von einem Wirkungsdualismus auszugehen. Wie oben dargestellt, ist der Grundsatz weltanschaulich-religiöser Neutralität in erster Linie ein objektives Verfassungsprinzip. Dieses objektive Verfassungsprinzip hat einen rechtlichen Selbststand. Der rechtliche Selbststand wird insbesondere daran deutlich, dass nach Auffassung des BVerfG der Neutralitätsgrundsatz als Verfassungsgut mit der Glaubensfreiheit in Widerstreit treten kann31. Wenn das Verfassungsprinzip in der rechtlichen Lage ist, als kollidierendes Verfassungsrecht die Glaubensfreiheit zu beschränken, so kann es auch isoliert den Maßstab für die Überprüfung eines staatlichen Rechtsaktes bilden. Eine hoheitliche Maßnahme wäre dann rechtswidrig, wenn ein Verstoß gegen den Neutralitätsgrundsatz vorliegt. Aufgrund der rein objektiven Wirkungsweise kann sich ein Bürger allerdings nicht auf die Verletzung des Neutralitätsgebotes berufen. Das hat die prozessuale Konsequenz, dass ein Bürger eine Neutralitätsverletzung nur innerhalb eines objektiven Beanstandungsverfahrens geltend machen kann32. Es bleibt somit festzuhalten, dass die isolierte Überprüfung des Neutralitätsgrundsatzes seitens des BayVGH rechtlich stringent war.
Ist ausgehend von diesem Befund das grundrechtliche Vorgehen des BVerwG abzulehnen? Nicht zwingend. Neben der isolierten Maßstabsfunktion als eigenständiges Verfassungsprinzip strahlt der Neutralitätsgrundsatz zusätzlich auch auf die Schutzbereichs- und Schrankendogmatik ein. Zum einen kann er die verfassungsrechtliche Grundlage für einen Grundrechtseingriff darstellen33. Zum anderen entfaltet er auch eine inhaltliche Wirkung auf die konkrete Grundrechtsprüfung. Besonders deutlich wird dies am Gewährleistungsgehalt von Art. 4 GG:
Hier bildet der Grundsatz staatlicher Neutralität die Grundlage34 für eine selbstverständnisorientierte Auslegung. Dem neutralen Staat ist es verwehrt, den konkreten Glauben seiner Bürger zu bewerten und zu definieren, welche religiösen Handlungsmodalitäten schutzwürdig sind. Deshalb wird dem Selbstverständnis des Grundrechtsträgers im Rahmen der Glaubensfreiheit ein entscheidender Spielraum bei der Schutzbereichsdefinition eingeräumt35.
Zum anderen bildet das Neutralitätsgebot eine wichtige Argumentationsgrundlage auf Abwägungsebene. Das Neutralitätsgebot kann hier schutzverstärkende Wirkung entfalten36. In diesem Sinne ist wohl auch die Formulierung des BVerwG zu verstehen, dass der Neutralitätsgrundsatz subjektiv-rechtliche Grundrechtsgewährleistungen verstärke und ergänze37. Dass eine objektivrechtliche Verfassungsbestimmung schutzverstärkende Wirkung auf Freiheitsrechte entfalten kann, ist kein dogmatisches Novum.
So entschied das BVerfG etwa im Kontext des Sonn- und Feiertagsschutzes gemäß Art. 139 WRV38, dass „verfassungsrechtliche Institutsgarantien ohnehin in ihrem jeweils spezifischen Gehalt auf Grundrechtsstärkung ausgerichtet sind“39. Diese Feststellung macht allerdings eine dogmatisch saubere Grundrechtsprüfung nicht entbehrlich. Ausgangspunkt ist stets das konkret zu prüfende Grundrecht. Im gleichheitsrechtlichen Kontext bedeutet das etwa, dass ein Vergleichspaar gebildet, eine Ungleichbehandlung festgestellt und anschließend die Frage gestellt werden muss, ob sich die Ungleichbehandlung rechtfertigen lässt. Im Rahmen der Rechtfertigungs- oder Ungleichbehandlungsprüfung kann dann der Neutralitätsgrundsatz als Argumentationshilfe verstärkend ins Spiel kommen. Von der Kreierung neuer Kombinationsgrundrechte40 (etwa Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG i. V. m. dem Neutralitätsgrundsatz) sollte allerdings abgesehen werden. In dieser Frage ist das Vorgehen des BVerwG nicht stringent. Das Gericht prüft zuerst einen möglichen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG, lehnt diesen dann aber unter Hinweis auf die lediglich passive Wirkung des Kreuzes ab41. Nach dieser Feststellung setzt das Urteil nun erneut an und überprüft, ob sich ein anderes Ergebnis durch eine Auslegung von Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG im Lichte des Grundsatzes weltanschaulich-religiöser Neutralität ergibt42. Im Anschluss daran erfolgt nun die isolierte Prüfung des Neutralitätsgrundsatzes, ohne erneut auf eine Ungleichbehandlung zu rekurrieren.
Hier wäre mehr dogmatische Klarstellung wünschenswert gewesen. Entweder prüft man den Neutralitätsgrundsatz isoliert oder (an den richtigen Stellen) eingebettet in die Grundrechtsprüfung.
Die bloße Feststellung einer subjektiv-rechtlichen Aufhängung des Neutralitätsgebotes mit anschließender objektivrechtlicher Prüfung überzeugt nicht.
3. […]
4. Fazit
Die Pflicht des Staates zu weltanschaulich-religiöser Neutralität ist ein objektives Verfassungsprinzip. Als solches entfaltet es Maßstabsfunktion zur Überprüfung staatlicher Rechtsakte.
Isoliert betrachtet folgen aus ihm keine subjektiven Rechtspositionen.
Neutralität ist in erster Linie eine Eigenschaftsbeschreibung des Staates. Darüber hinaus wirkt der Neutralitätsgrundsatz aber auch auf die Grundrechtsdogmatik ein und modifiziert diese (Schutzverstärkung).
Durch das Anbringen der Kreuze im Eingangsbereich von Behörden identifiziert sich der Freistaat Bayern zumindest mittelbar mit der Religion des Christentums, wodurch der Neutralitätsgrundsatz tangiert wird. Daran vermag auch die Zweckbestimmung in § 28 AGO nichts zu ändern. Das Kreuz kann von seiner religiösen Bedeutung nicht entkoppelt werden.
Ob diese Identifikation auch zu einem Verstoß gegen das Neutralitätsgebot führt, hängt maßgeblich davon ab, ob man im Sinne des BVerwG eine Erheblichkeitsschwelle fordert oder ob jede Identifikation des Staates mit einer Religion einen solchen Verstoß nach sich zieht. In einem nicht-laizistischen System scheint die Annahme einer gewissen Erheblichkeitsschwelle überzeugender. Die hiesige Identifikation dürfte aufgrund der passiven Wirkung des Kreuzes und der nur flüchtigen Konfrontation nicht erheblich genug sein, um einen Verstoß gegen das Neutralitätsgebot zu begründen. Dieses Ergebnis hinterlässt allerdings einen faden Beigeschmack.
Durch die zumindest mittelbare Identifikation mit dem Christentum betritt der Freistaat verfassungsrechtlich sensibles Terrain. Der bayerische Kreuzerlass bewegt sich in bewusster Weise an der äußeren Grenze des Neutralitätsgebots.
Die Entscheidungen des BayVGH und des BVerwG zeigen eindrücklich, dass die juristische Bewältigung der Problematik eine Wanderung auf schmalem Grat ist.
* Der Verfasser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Wirtschaftsrecht (Prof. Dr. Markus Möstl) an der Universität Bayreuth.
1 BVerwG, U.v. 19.12.2023 – 10 C 5.22 – BayVBl. 2024, 681 = NVwZ 2024, 673.
2 BayVGH, U.v. 01.06.2022 – 5 B 22.674 (rechtskräftig) – BayVBl. 2023, 12 ff. = BeckRS 2022, 23724.
3 BayVGH BayVBl. 2023, 12/13 = BeckRS 2022, 23724 Rn. 22.
4 Etwa Herbolsheimer/Kukuczka, ZevKR 63 (2018), 367 ff.; Walter in FS Streinz, 2023, S. 601 ff.; Steinz, BayVBl. 2021, 577/579; Halbig, NVwZ 2021, 768 ff.; Friedrich, NVwZ 2018, 1007 ff.; Muckel, JA 2023, 262 ff.; Hecker, NVwZ 2024, 675 ff.; T. Aydin, NVwZ 2024, 1072 ff.
5 BayVGH BayVBl. 2023, 12/14 = BeckRS 2022, 23724 Rn. 28.
6 BVerwG NVwZ 2024, 673/674 Rn. 24.
7 So auch Hecker, NVwZ 2024, 675/676.
8 Näher zur Rechtsprechungsentwicklung des BVerfG Walter in Handbuch des Staatskirchenrechts, 3. Aufl. 2020, § 18 Rn. 15 ff.
9 Näher zur normtheoretischen Frage, ob es sich bei dem Neutralitätsgrundsatz um ein „Prinzip“ oder eine „Regel“ handelt Bornemann, Die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates, 2020, S. 106 ff.; Herbolsheimer/ Kukuczka, ZevKR 63 (2018), 367/378 f. Im Folgenden werden daher die Begriffe „Neutralitätsgebot“ und „Neutralitätsgrundsatz“ verwendet. Daneben soll auch – entsprechend der VGH-Terminologie – der Begriff des Verfassungsprinzips zur Anwendung kommen, vgl. BayVGH BayVBl. 2023, 12/14 = BeckRS 2022, 23724 Rn. 28.
10 Zuletzt BVerfGE 153, 1/36 Rn. 87.
11 BVerfGE 93, 1/16.
12 BVerwG NVwZ 2024, 673/674 Rn. 24.
13 BayVGH BayVBl. 2023, 12/13 = BeckRS 2022, 23724 Rn. 23.
14 Für Letzteres plädieren etwa Herbolsheimer/Kukuczka, ZevKR 63 (2018), 367/371.
15 Huster, Die ethische Neutralität des Staates, 2002, S. 233. Zur Unterscheidung von „positiver“ und „negativer“ Neutralität näher Bornemann, Die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates, 2020, S. 124 ff.
16 Schlaich, Neutralität als verfassungsrechtliches Prinzip, 1972, S. 254.
17 BVerfGE 153, 1/36 f. Rn. 87.
18 BVerfGE 138, 296/339 Rn. 109.
19 BVerfGE 153, 1/37 Rn. 88.
20 Herbolsheimer/Kukuczka, ZevKR 63 (2018), 367/369.
21 In diese Richtung auch Di Fabio in Dürig/Herzog/Scholz, 103. EL 2024, Art. 4 GG Rn. 198; Friedrich, NVwZ 2018, 1007/1009.
22 Grundlegend Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation in Böckenförde, Recht, Staat, Freiheit, 2006, S. 92 ff.
23 Böckenförde, NJW 1974, 1529/1533 f.
24 Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, 1928, S. 163.
25 Vgl. Huster, Die ethische Neutralität des Staates, 2002, S. 664: „Ob das Neutralitätsgebot einen objektivrechtlichen Grundsatz in dem Sinne darstellt, daß es unabhängig von dem subjektiven Grundrechtsschutz zur Anwendung gebracht werden kann, läßt sich daher nicht isoliert erklären; es hängt davon ab, ob und inwieweit man generell bereit ist, aus den Grundrechten objektivrechtliche Anforderungen abzuleiten.“
26 Zur Wirkung der speziellen Gleichheitsrechte als objektive Wertentscheidungen etwa BVerfGE 17, 1/27.
27 So auch Di Fabio in Dürig/Herzog/Scholz, 103. EL 2024, Art. 4 GG Rn. 198; G. Czermak/E. Hilgendorf, Religions- und Weltanschauungsrecht, 2. Aufl. 2018, Rn. 175; Kästner in Stern/Becker, Grundrechtekommentar, 2. Aufl. 2016, Art. 4 GG Rn. 175 f.; Friedrich, NVwZ 2018, 1007/1009; Waldhoff, JuS 2022, 1182/1184.
28 Herbolsheimer/Kukuczka, ZevKR 63 (2018), 367/371.
29 BVerwG NVwZ 2024, 673/674 Rn. 24.
30 BVerwG NVwZ 2024, 673/675 Rn. 28.
31 So explizit BVerfGE 153, 1/36 Rn. 86.
32 Das wäre etwa der Fall, wenn eine Satzung oder eine Rechtsverordnung gegen das Neutralitätsprinzip verstößt und sich ein Bürger mittels Normenkontrollantrages nach § 47 VwGO dagegen wehrt. Sofern er in der Zulässigkeit die Hürde der Antragsbefugnis nimmt (bspw. mittels einer möglichen Verletzung der negativen Religionsfreiheit), könnte das OVG/ der VGH i.R.d. Begründetheit dennoch eine Verletzung des Neutralitätsprinzips feststellen, was dann zur Nichtigkeit der Rechtsnorm führen würde. Näher zur objektiven Rechtskontrolle bei § 47 VwGO Panzer/ Schoch in Schoch/Schneider, 44. EL 2023, § 47 VwGO Rn. 88.
33 Vgl. BVerfGE 153, 1/36 Rn. 86.
34 Vgl. BVerfGE 138, 296/339 Rn. 110, wonach es dem Staat verwehrt ist den Glauben seiner Bürger zu bewerten und inhaltlich zu definieren, was unter „Religion“ und „Religionsausübung“ zu verstehen ist.
35 Di Fabio in Dürig/Herzog/Scholz, 103. EL 2024, Art. 4 GG Rn. 80 f. Umfassend dazu Isak, Das Selbstverständnis der Kirchen und Religionsgemeinschaften und seine Bedeutung für die Auslegung des staatlichen Rechts, 1994; Muckel, Religiöse Freiheit und staatliche Letztentscheidung – Die verfassungsrechtlichen Garantien religiöser Freiheit unter veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen, 1997, S. 71 ff.
36 Besondere Prominenz erlangte die Figur der Schutzverstärkung in der Schächten-Entscheidung des BVerfG, vgl. BVerfGE 104, 337/346. Hier trat die Religionsfreiheit verstärkend zur Berufsfreiheit (in diesem Fall geschützt über Art. 2 Abs. 1 GG) des Metzgers hinzu. Näher dazu Hofmann, AöR 133 (2008), 523 ff. Die Terminologie des BVerfG ist allerdings missverständlich, indem es von einer Schutzbereichsverstärkung spricht. Es kommt nämlich nicht zu einer Verstärkung des Schutzbereiches, sondern des Schutzniveaus bzw. der Schutzintensität, sodass der Begriff „Schutzverstärkung“ treffender ist, vgl. Jarass in Jarass/Pieroth, 17. Aufl. 2022, Vorb. zu Art. 1 GG Rn. 17a.
37 BVerwG NVwZ 2024, 673/675 Rn. 28.
38 Art. 139 WRV enthält lediglich eine „objektivrechtliche Institutsgarantie ohne subjektive Berechtigung “, BVerfG NJW 1995, 3378/3379.
39 BVerfGE 125, 39 (83).
40 Dazu umfassend I. Augsberg/S. Augsberg, AöR 132 (2007), 539 ff.
41 BVerwG NVwZ 2024, 673/674 Rn. 20 ff.
42 BVerwG NVwZ 2024, 673/674 Rn. 24.
Den vollständigen Beitrag lesen Sie in Bayerische Verwaltungsblätter 19/2024, S. 655.