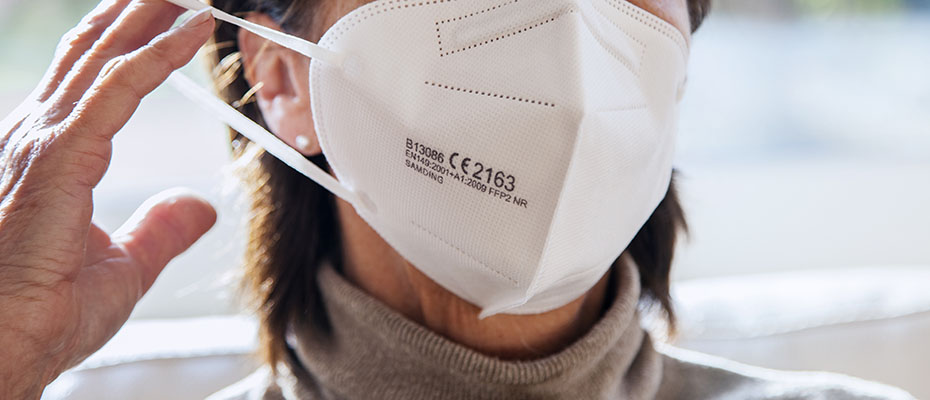Mit einigen prinzipiellen Einwänden gegen die Fremdenverkehrsbeitragspflicht eines privaten Vermieters hatte sich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in seinem unten vermerkten Beschluss vom 21.6.2024 auseinanderzusetzen.
Nach der Fremdenverkehrsbeitragssatzung (FBS) des beklagten Marktes wird ein Fremdenverkehrsbeitrag u.a. von allen selbständig tätigen natürlichen und juristischen Personen erhoben, denen durch den Fremdenverkehr im Gemeindegebiet Vorteile erwachsen (§ 1 FBS). Zur Bestimmung des jeweiligen Vorteils und damit als Beitragsmaßstab dienen der einkommen- oder körperschaftsteuerpflichtige Gewinn und der steuerbare Umsatz innerhalb eines Kalenderjahres (§ 2 Abs. 2 Satz 1 FBS). Der Kläger, der ein Gästehaus im Gemeindegebiet an den Betreiber eines Hotels vermietet hatte, wurde aufgrund dessen zu einem jährlichen Fremdenverkehrsbeitrag in Höhe von 232,44 Euro herangezogen. Bei der Berechnung legte der Beklagte die vom Kläger erklärten jährlichen Mieteinnahmen in Höhe von 40.994,76 Euro als steuerbaren Umsatz, einen Vorteilssatz von 90 % und einen Mindestbeitragssatz von 0,63 % zugrunde. Den Vorteilssatz, mit dem der auf dem Fremdenverkehr beruhende Teil des steuerbaren Umsatzes bestimmt wurde, leitete der Beklagte dabei aus demjenigen Vorteilssatz ab, der zuvor beim Mieter des Klägers unwidersprochen angesetzt worden war.
Die gegen den Beitragsbescheid nach erfolglosem Widerspruchsverfahren erhobene Klage wies das Verwaltungsgericht ab. Auch der daraufhin vom Kläger gestellte Antrag auf Zulassung der Berufung hatte keinen Erfolg. Der Beschluss des VGH befasst sich im Wesentlichen mit folgenden Punkten:
1. Der Fremdenverkehrsbeitragspflicht unterliegen auch Einnahmen, die keine Gewinneinkünfte im einkommensteuerrechtlichen Sinne sind
Das Gericht verweist insoweit auf eine seit langem feststehende Rechtsprechung:
„Der Kläger rügt, das Verwaltungsgericht habe zu Unrecht angenommen, Art. 6 Abs. 1 KAG beschränke die Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen nicht auf Gewinneinkünfte im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG; dadurch werde die private Vermietung der gewerblichen Vermietung gleichgestellt. Bei der privaten Vermietung werde gerade kein ,steuerbarer Umsatz‘ oder ,einkommensteuerlicher Gewinn‘ nach § 2 Abs. 2 FBS erzielt.
Mit diesem Vorbringen wird kein tragender Rechtssatz des Verwaltungsgerichts in Frage gestellt. In der Rechtsprechung des Senats ist geklärt, dass der Begriff der selbständigen Tätigkeit im Fremdenverkehrsbeitragsrecht weiter geht als im Steuerrecht. Die Funktion dieses Tatbestandsmerkmals in Art. 6 KAG erschöpft sich darin, unselbständig tätige Arbeitnehmer von der Beitragspflicht auszunehmen (stRspr, vgl. BayVGH, U.v. 9.5.2016 – 4 B 15.2338 – KStZ 2016, 194 Rn. 21 m.w.N.). Diese Rechtsprechung wurde vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof in seiner Entscheidung vom 24.5.2019 ausdrücklich bestätigt (Bay- VerfGH, E.v. 24.5.2019 – Vf. 23-VI-17 – NVwZ-RR 2019, 881 Rn. 59). Es sei verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, den Begriff der ,selbständig tätigen Person‘ in Art. 6 Abs. 1 KAG auch auf die nicht gewerbsmäßige Vermietung und Verpachtung von Räumen zu erstrecken, auch wenn diese Tätigkeit (einkommen-) steuerrechtlich in der Regel der privaten Vermögensverwaltung zuzurechnen sei. Mit dieser Rechtsprechung setzt sich die Zulassungsbegründung nicht weiter auseinander. Der Begriff des ,Umsatzes‘ in § 2 Abs. 2 FBS entspricht in diesem Fall den erzielten Mieteinnahmen; der Begriff des Gewinns ist mit dem Überschuss der Einnahmen über dieWerbungskosten gleichzusetzen. Für eine vom Satzungsgeber intendierte, über Art. 6 Abs. 1 KAG hinausgehende Begrenzungswirkung der Begriffe sind Anhaltspunkte weder vorgetragen noch ersichtlich.“
2. Zur Schätzung des Vorteilssatzes des nur mittelbar durch den Fremdenverkehr Begünstigten
Die für diese Fallgruppe geltenden Grundsätze fasst der VGH wie folgt zusammen:
„Soweit der Kläger der Sache nach weiter vortragen lässt, das Verwaltungsgericht habe zu Unrecht keinen eigenen Vorteilssatz des Klägers bestimmt, sondern nur den Vorteilssatz des Mieters herangezogen, wird ebenfalls kein tragender Rechtssatz in Frage gestellt. Nach der Rechtsprechung des Senats darf der Beitragsermittlung für den mittelbaren Vorteil aus dem Fremdenverkehr ein dem jeweiligen unmittelbaren Vorteil entsprechender Vorteilssatz zu Grunde gelegt werden (vgl. BayVGH, B.v. 16.8.2002 – 4 ZB 02.756 – juris Rn. 2). Dies gilt jedenfalls dann, wenn wie hier beim Betrieb eines Hotels der unmittelbare Vorteil des Betreibers aus dem Fremdenverkehr auf den mittelbaren Vorteil des Vermieters der Räume durchschlägt, der aufgrund der Vermietung bzw. Verpachtung direkt am unmittelbaren Vorteil des Betreibers partizipiert. Da der Kläger selbst nur mittelbar durch den Fremdenverkehr begünstigt wird, ist es zwingend, dass der unmittelbare Vorteil seines Pächters auch bei ihm die entsprechende Berechnungsgrundlage bildet. Zutreffend ist zwar, dass die Richtigkeit des Vorteilssatzes nicht allein daraus hergeleitet werden kann, dass die Pächter den für sie festgesetzten Vorteilssatz ohne Beanstandung hingenommen haben (BayVGH, U.v. 9.5.2016 – 4 B 15.2338 – KStZ 2016, 194 Rn. 24). Nach der Rechtsprechung des Senats kommt dem allerdings eine Indizwirkung zu. Die Schätzung des Vorteilssatzes ist rechtlich nicht zu beanstanden, insbesondere auch mit dem Rechtsstaatsprinzip vereinbar (BayVGH, U.v. 5.12.2006 – 4 B 05.3119 – juris Rn. 28). Ein anderer sachgerechter Ansatzpunkt ist nicht ersichtlich und auch von dem Kläger nicht dargelegt. Mit dem Einwand, erhöhte Übernachtungszahlen erhöhten beim Vermieter die umzulegenden Nebenkosten und damit ohne Sachgrund die Bemessungsgrundlage, wendet er sich abstrakt gegen eine von ihm angenommene Berechnungsmodalität, nicht aber gegen den dem Vorteilssatz zugrundeliegenden Ansatz, dass fremdenverkehrsbedingte Vorteile eines Betreibers Rückwirkungen auf die erzielbaren Mieteinnahmen haben. Auch der konkrete Satz von 90 % wird dadurch nicht substantiiert in Frage gestellt.“
3. Von einer unzulässigen beitragsrechtlichen Doppelbelastung kann nur bei Personenidentität gesprochen werden
Zur Klarstellung weist das Gericht abschließend noch auf Folgendes hin:
„Auch der sinngemäße Einwand, durch die mietvertragliche Umlage des Fremdenverkehrsbeitrags auf den Vermieter komme es bei diesem zu einer unzulässigen Doppelbelastung, kann ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung des Verwaltungsgerichts nicht begründen. Die vom Kläger angesprochene Frage der privatrechtlichen Wirksamkeit derartiger Vereinbarungen ist für den Ausgang des Rechtsstreits nicht entscheidungserheblich.
Einer beitragsrechtlichen ,Doppelbelastung‘ (vgl. dazu BVerwG, U.v. 26.2. 1992 – 8 C 70.89 – NVwZ 1992, 668 Rn. 12 ff.) können im Einzelfall das aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) wurzelnde Verhältnismäßigkeitsprinzip oder das Gleichheitsgebot (Art. 3 Abs. 1 GG) entgegenstehen. Dabei kommt es auf die Identität des Vorteils im beitragsrechtlichen Sinne an (vgl. BayVGH, B.v. 28.9.2011 – 4 ZB 11.723 – juris Rn. 11). Dies hat etwa zur Folge, dass die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrags für Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft ausgeschlossen ist, soweit bereits die Gesellschaft zu der Abgabe herangezogen wird (BayVGH a.a.O.; B.v. 18.3.2009 – 4 CS 08.3051 – juris Rn. 8). Eine solche Personenidentität ist bei dem Kläger und seinem Mieter nicht gegeben. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats, die der Bayerische Verfassungsgerichtshof nicht beanstandet hat (BayVerfGH, E.v. 27.3.2001 – Vf. 62-VI-00 – NVwZ 2001, 797), ist eine ,Doppelbelastung‘ im System des bayerischen Fremdenverkehrsbeitragsrechts durch die gesetzliche Vorgabe vorgezeichnet, soweit sowohl der unmittelbare als auch der mittelbare Vorteil für beitragsrechtlich relevant erklärt wird. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Doppelbelastung im beitragsrechtlichen Sinn; denn beitragspflichtig sind jeweils unterschiedliche Personen auf der Grundlage eines für beide gesondert ermittelten Umsatzes und Gewinns (BayVGH, U.v. 13.5.1992 – 4 B 90.1142).“
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 21.6.2024 – 4 ZB 22.242
Beitrag entnommen aus Die Gemeindekasse Bayern 20/2024, Rn. 170.