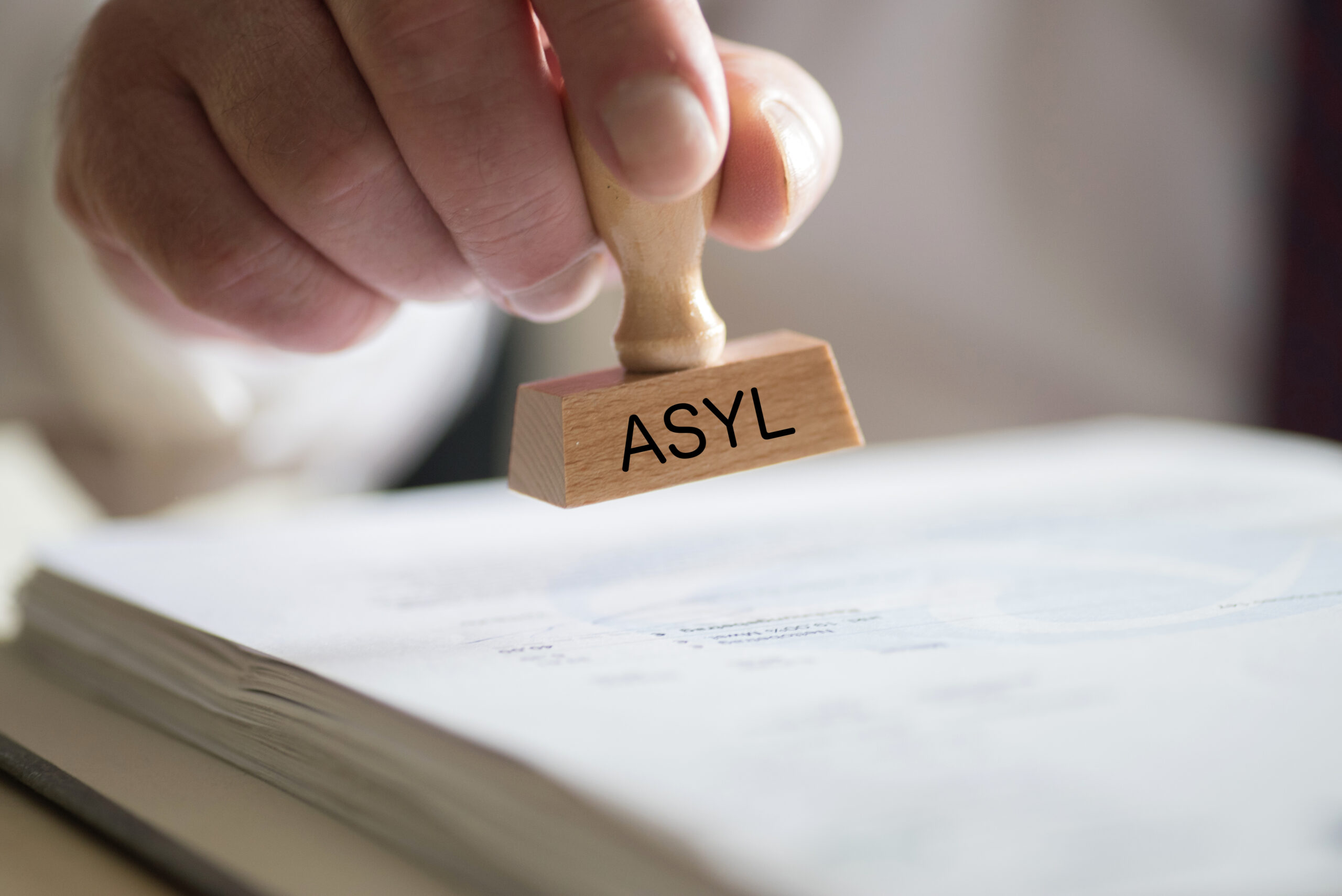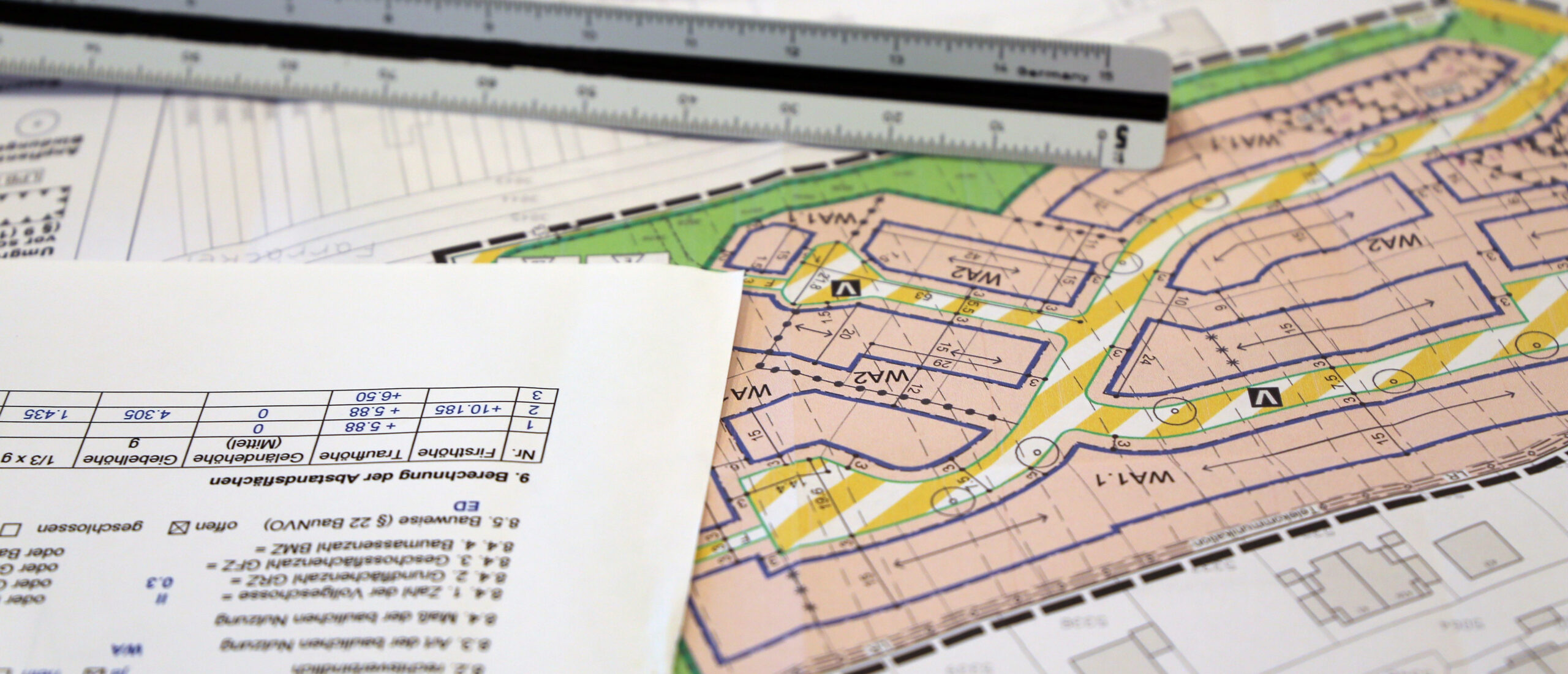Die Frage, ob hauptberufliche Arbeitnehmer einer Gemeinde zugleich ein Gemeinderatsmandat wahrnehmen dürfen, war Gegenstand des unten vermerkten Beschlusses des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) vom 13.5.2024.
Es ging um einen bei der Kommunalwahl 2020 in den Stadtrat der Antragsgegnerin gewählten Mitarbeiter (den Antragsteller), dem nachträglich das Mandat aberkannt worden war. Die Mehrheit des Stadtrats war der Auffassung, dass er aufgrund seines seit 1995 bei der Antragsgegnerin bestehenden Beschäftigungsverhältnisses als Schiffsführer auf dem Altmühlsee nicht der örtlichen Vertretungskörperschaft angehören konnte. Die Personenschifffahrt auf dem Altmühlsee wird von dem gleichnamigen Zweckverband betrieben, dem neben anderen Gebietskörperschaften auch die Antragsgegnerin angehört. Gemäß einer speziellen Zweckvereinbarung bedient sich der Zweckverband für die Führung seiner sämtlichen anfallenden Verwaltungsgeschäfte des Personals der Antragsgegnerin.
Diese hat zu diesem Zweck u.a. das notwendige Personal gegen eine Kostenerstattung zur Verfügung zu stellen. Ergänzend wurde vereinbart, dass der Zweckverband der Antragsgegnerin u.a. die Personalkosten für einen Schiffsführer vollständig erstattet. Der Antragsteller ist ausschließlich für den Zweckverband tätig und nur in der dortigen Telefonliste verzeichnet.
Nachdem die Rechtsaufsichtsbehörde im Nachgang zur Kommunalwahl Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit der beruflichen Tätigkeit des Antragstellers mit seiner Ratsmitgliedschaft geäußert hatte, stellte der Stadtrat der Antragsgegnerin mit Beschluss vom 7.3.2024 mit sofortiger Wirkung den Verlust des Stadtratsmandats fest.
Ein vom Antragsteller daraufhin beim Verwaltungsgericht gestellter Eilantrag hatte Erfolg. Das Gericht stellte im Wege einer einstweiligen Anordnung vorläufig fest, dass der Antragsteller entgegen dem Beschluss des Stadtrates der Antragsgegnerin weiterhin dessen Mitglied ist. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Antragsgegnerin wurde zurückgewiesen; der VGH erläuterte in seinem Beschluss die ungeschriebenen verfassungsrechtlichen Grenzen der geltenden Inkompatibilitätsvorschriften:
1. Art. 137 Abs. 1 GG ermächtigt auch für den Bereich des Kommunalrechts zum Erlass gesetzlicher Inkompatibilitätsvorschriften
Einleitend skizziert der VGH den verfassungsrechtlichen Rahmen der Regelung:
„Der Antragsteller ist nicht als Arbeitnehmer der Antragsgegnerin im Sinne des Art. 31 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GO a.F. anzusehen. Gemäß dieser Vorschrift kann u.a. ein hauptberuflicher Arbeitnehmer der betreffenden Gemeinde kein ehrenamtliches Gemeinderatsmitglied sein. Als Arbeitnehmer im Sinn des Satzes 1 gilt gemäß Satz 2 der Vorschrift nicht, wer überwiegend körperliche Arbeit verrichtet. Art. 31 GO ist vorliegend gemäß Art. 120b Abs. 2 Satz 1 GO in der bis 31.12.2023 geltenden Fassung vom 22.3.2018 anzuwenden, da der Antragsteller sein Amt am 31.12.2023 ausgeübt hat.
Diese mit der Bayerischen Verfassung vereinbare Inkompatibilitätsregelung (vgl. BayVerfGH, B. v. 25.7.1974 – Vf. 43-VII-72 – VerfGHE 27, 101) beruht auf Art. 137 Abs. 1 GG, wonach u.a. die Wählbarkeit von Angestellten des öffentlichen Dienstes in den Gemeinden gesetzlich beschränkt werden kann. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. B. v. 4.4.1978 – 2 BvR 1108/77 – BVerfGE 48, 64 = juris Rn. 59) dient diese Ermächtigungsnorm allgemein der Sicherung der organisatorischen Gewaltenteilung gegen Gefahren, die durch das Zusammentreffen von Amt und Mandat entstehen können. Verhindert werden solle insbesondere, dass ,öffentlich Bedienstete‘ demjenigen Vertretungsorgan angehören, dem eine Kontrolle über ihre Behörde obliegt. Ein solches Schutzbedürfnis bestehe ebenso im Bereich der Kommunen. Es lasse sich mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung nicht ohne weiteres vereinbaren, wenn dieselbe Person kommunaler Bediensteter sei und zugleich dem kommunalen Vertretungsorgan angehöre, denn gerade auf lokaler Ebene sei die Gefahr gewisser Verflechtungen nicht von der Hand zu weisen (vgl. auch BayVGH, U. v. 20.10.20031) – 4 BV 02.2985 – VGH n.F. 56, 227 Rn. 15).“
2. Die Ermächtigungsnorm des Art. 137 Abs. 1 GG bedarf im Hinblick auf ihren Schutzzweck einer einschränkenden Auslegung
Insoweit verweist der Senat auf die einschlägige höchstrichterliche Rechtsprechung:
„Art. 137 Abs. 1 GG ermächtigt nicht zur Beschränkung der Wählbarkeit sämtlicher Arbeitnehmer, sondern nur der Angestellten des öffentlichen Dienstes. Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat in seinem Urteil vom 14.6.2017 – 10 C 2.16 – BVerwGE 159, 113 Rn. 22 ausgeführt, bei Erlass des Grundgesetzes habe das Arbeitsrecht zwischen Angestellten und Arbeitern unterschieden; nachdem das Arbeitsrecht diese begriffliche Unterscheidung aufgegeben und den einheitlichen Begriff des Arbeitnehmers eingeführt habe, müssten die gesetzlichen Bestimmungen über Wählbarkeitsbeschränkungen die in Art. 137 Abs. 1 GG unverändert angelegte Unterscheidung auf andere Weise fortführen. Dies könne dadurch geschehen, dass vom umfassenden Begriff des Arbeitnehmers diejenigen ausgenommen würden, die überwiegend körperliche Arbeit verrichteten. In diesem Urteil hat das BVerwG darüber hinaus die Art. 31 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 GO a.F. sinngemäß entsprechende, auf Landkreisbedienstete bezogene Vorschrift des § 24 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a und Satz 2 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg (BWLKrO) dahin verfassungskonform einschränkend ausgelegt, dass davon solche Arbeitnehmer nicht erfasst sind, die nach ihrem dienstlichen Tätigkeitsbereich keine Möglichkeit haben, inhaltlich auf die Verwaltungsführung des Landkreises oder des Landratsamtes Einfluss zu nehmen (a.a.O. Rn. 30). Eine Begrenzung der Wählbarkeit im kommunalen Bereich bedürfe eines sachlichen Grundes, der dem Sinn der verfassungsrechtlichen Ermächtigung gerecht werde. Sie sei deshalb nur gerechtfertigt, wenn ansonsten der Gefahr von Interessenkollisionen nicht wirksam zu begegnen sei (a.a.O. Rn. 27). Differenzierungen anhand bestehender Gefahren von Interessenkonflikten müssten bereits auf der Ebene des Gesetzes getroffen werden. Das schließe freilich nicht aus, dem Gesetz die gebotene Differenzierung erst im Wege der Auslegung zu entnehmen, wenn dies in der Regelung selbst angelegt oder aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten sei (a.a.O. Rn. 28).“
[…]Beitrag entnommen aus Fundstelle Bayern 4/2025, Rn. 34.