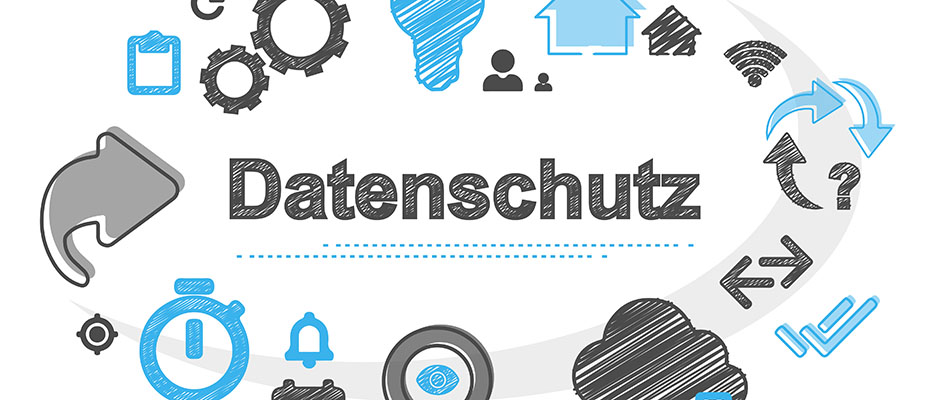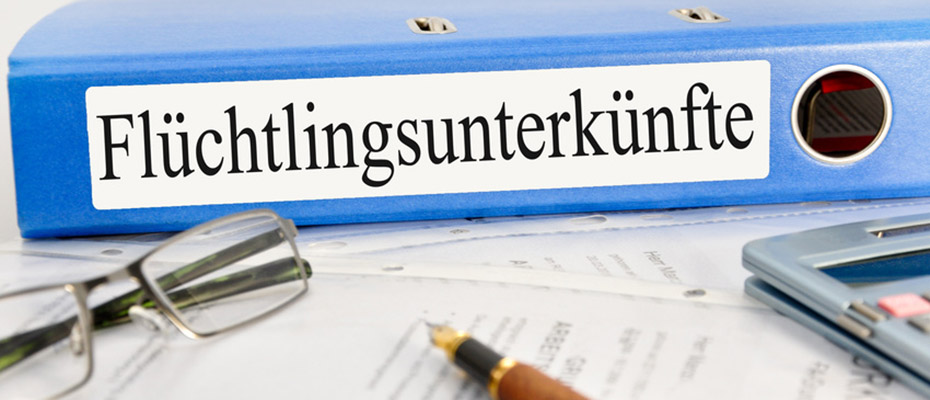Die Digitalisierung macht auch vor der Verwaltung nicht halt. Veröffentlichungspflichtige Mitteilungen und amtliche Verkündungsblätter sollen allemal „auch“ (im Sinne von: zusätzlich, ergänzend) digital bekannt gemacht werden (Art. 17 Abs. 3 Satz 1 BayDiG). Bekanntmachungen können überdies – soweit nicht rechtliche Vorgaben entgegenstehen – ausschließlich digital erfolgen, wenn eine Veränderung der veröffentlichten Inhalte ausgeschlossen ist und die Einsichtnahme (insbesondere für „Offliner“) auch unmittelbar bei der die Veröffentlichung veranlassenden Stelle auf Dauer gewährleistet wird (Art. 17 Abs. 3 Satz 2 BayDiG).
Ist durch Rechtsvorschrift eine öffentliche oder ortsübliche Bekanntmachung angeordnet, so ist diese im Übrigen dadurch zu bewirken, dass der Inhalt der Bekanntmachung grundsätzlich auch auf einer Internetseite der Behörde oder ihres Verwaltungsträgers zugänglich gemacht wird (Art. 27a [Abs 1 Satz 1] und 27b [Abs. 1 Satz 1 Nr. 1] BayVwVfG in der Fassung des Gesetzes vom 23. Dezember 2024, GVBl. S. 599, in Kraft seit 1. Januar 2025; siehe auch §§ 27a und 27b VwVfG in der Fassung des Gesetzes vom 04.12.2023, BGBl. I Nr 344, ferner § 10 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 7 [Satz 3] mit Abs. 8 Satz 2 sowie Abs. 8a BImSchG in der Fassung des Gesetzes vom 3. Juli 2024, BGBl. I Nr. 225). Was aber ist hierbei im Hinblick auf den Datenschutz zu beachten?
Dies soll in drei Schritten untersucht werden. Zunächst werden Zweck und Gegenstand des Datenschutzes in den Blick genommen (dazu unter 1.). Sodann gilt es herauszufinden, für welche Art von digitalen amtlichen Bekanntmachungen das Datenschutzrecht von Bedeutung ist (dazu unter 2.). Welche Konsequenzen dies für die betreffenden Bekanntmachungen hat, soll abschließend (unter 3.) aufgezeigt werden.
1. Datenschutz betrifft die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 1 VO (EU) 2016/679 bzw. DSGVO). Personenbezogene Daten sind dabei alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen (Art. 4 Nr. 1 DSGVO), somit insbesondere deren Namen und (Wohn-)Anschrift. Solche Daten im Internet zum Abruf bereitzustellen, ist eine Form ihrer Verarbeitung gemäß Art. 4 Nr. 2 DSGVO. Soweit überhaupt notwendig1, dürfen sie freilich nur im Rahmen gesetzlich festgelegter Zwecke – darunter zur Erfüllung behördlicher Aufgaben, sofern hierfür erforderlich – (erhoben und weiter-)verarbeitet werden (Art. 5 Abs. 1 lit. b und Art. 6 Abs. 1 lit. c und e mit Abs. 3 DSGVO, Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayDSG).
2. Amtlich veröffentlicht – und zwar (auch) auf digitalem Wege – werden neben abstrakt-generellen Normen oder Normentwürfen (siehe etwa § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB) auch in bestimmtem Umfang (und i. d. R. fakultativ) individuell-konkrete Verwaltungsakte beziehungsweise diesbezügliche Anträge, so
- der verfügende Teil öffentlich bekanntgebbarer Verwaltungsakte, sofern eine digitale Bekanntmachung ortsüblich ist oder die Bekanntmachung über ein digitales amtliches Veröffentlichungsblatt erfolgt (vgl. insbesondere Art. 41 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 – auch in Verbindung mit Art. 74 Abs. 5 – BayVwVfG; ferner: Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und Art. 66a Abs. 1 Satz 3 sowie Abs. 2 Satz 3 BayBO, außerdem § 10 Abs. 7 Satz 3 und Abs. 8 Satz 2 – auch in Verbindung mit Abs. 9 – BImSchG2), sowie
- Anträge auf den Erlass bestimmter Verwaltungsakte wie zum Beispiel nach Art. 73 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 27b (Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) BayVwVfG oder § 10 Abs. 3 (Satz 1) BImSchG.
Solche Bekanntmachungen enthalten vor allem die Namen und Anschriften der (unmittelbaren) Verwaltungsaktadressaten beziehungsweise -antragsteller3. Sind dies natürliche Personen, handelt es sich dabei um personenbezogene Daten im Sinn von Art. 4 Nr. 1 DSGVO.
3. Derartige Daten im Internet zu präsentieren und damit allgemein zugänglich zu machen, erfordert einen rechtfertigenden Zweck (s. oben unter 1.). Diese Zweckbindung hat auch eine zeitliche Dimension. Die öffentliche Kundgabe eines Verwaltungsaktes beziehungsweise eines darauf gerichteten Antrags dient der Information der davon (potenziell) Betroffenen; Anträge dieser Art sind in aller Regel einen Monat lang bekannt zu machen (vgl. Art. 73 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit Art. 27b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayVwVfG, Art. 66a Abs. 2 Satz 1 f. und Abs. 2 Satz 1 BayBO, § 10Abs. 3 Satz 2 f. BImSchG), daraus resultierende Verwaltungsakte regelmäßig zwei Wochen, um als bekanntgegeben zu gelten (siehe Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG – auch in Verbindung mit Art. 66a Abs. 2 Satz 3 BayBO –, Art. 74 Abs. 5 Satz 2 in Verbindung mit Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG sowie § 10 Abs. 8 [Satz 3 f.] BImSchG). Jeweils so lange ist auch eine Veröffentlichung im Internet gerechtfertigt, länger aber – in Anbetracht der unbegrenzten Verfügbarkeit und zudem der beliebigen Verknüpfbarkeit und Auswertbarkeit von digital bereitgestellten Daten – nicht4, weshalb personenbezogene Daten nach Ablauf der genannten Fristen online unkenntlich zu machen sind.
Bei digitalen Veröffentlichungen begleitender Natur (so gem. Art. 17 Abs. 3 Satz 1 BayDiG) steht dem nichts entgegen. Problematisch jedoch wird es, wenn die offiziell maßgebliche Bekanntmachung über ein ausschließlich digitales Amtsblatt im Sinn von Art. 17 Abs. 3 Satz 2 BayDiG (bzw. Art. 26 Abs. 2 Satz 2 GO5) erfolgen soll, da nach ebendieser Bestimmung eine (nachträgliche) Veränderung der veröffentlichten Inhalte zur Wahrung der Authentizität und Integrität des Amtsblatts ausdrücklich ausgeschlossen wird und auch keine Ausnahme aus Gründen des Datenschutzes – vergleichbar etwa § 6 Abs. 2 VkBkmG6 – vorgesehen ist. Solange dies aber gilt, eignen sich ausschließlich digital veröffentlichte Amtsblätter nicht für Bekanntmachungen, die nur temporär zu publizierende personenbezogene Daten beinhalten. Insofern bleibt der Landesgesetzgeber aufgerufen, Digitalisierung und Datenschutz noch in Einklang zu bringen.
1 Insofern gilt der Grundsatz der Datenminimierung nach Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO.
2 Nach § 10 Abs. 8 Satz 3 f. in Verbindung mit Abs. 3 Satz 1 BImSchG ist überdies der gesamte Bescheid (samt Rechtsbehelfsbelehrung) (auch) auf der behördlichen Internetseite öffentlich bekannt zu machen, was in ähnlicher Weise für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (Richtlinie 2010/75/EU vom 24.11.2010, ABl. L 334, S. 17, geändert durch Richtlinie (EU) 2024/1785 v. 24.04.2024, ABl. L v. 15.07.2024, S. 1) schon gem. § 10 Abs. 8a BImSchG gilt.
3 S. hierzu exemplarisch § 10 Abs. 3 Satz 1 BImSchG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 und § 3 (Satz 1 Nr. 1) 9. BImSchV.
4 S. Bayer. Landesbeauftragter für den Datenschutz, 25. Tätigkeitsbericht (2012), Nr. 6.1, und 27. Tätigkeitsbericht (2017), Nr. 6.11 (abrufbar unter www.datenschutz-bayern.de, Rubrik: Tätigkeitsberichte). Die uneingeschränkte Bedeutung des Datenschutz(recht)es hebt im Übrigen auch die Gesetzesbegründung zu Art. 17 BayDiG eigens hervor, s. LT-Drs. 18/ 19572 S. 60 (Zu Abs. 3 Satz 1, 2. Absatz) und S. 61 (Zu Abs. 3, letzter Absatz).
5 Seit seiner Novellierung durch Art. 57a Abs. 2 Nr. 1 BayDiG (s. dazu LTDrs. 18/19572 S. 37 und 100 sowie FStBay 2023 Rn. 214 Ziff. 12). Voraussetzung dafür ist eine entsprechende Regelung in der Geschäftsordnung oder ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss, s. § 1 Abs. 1 Bay- KommV.
6 S. dazu BT-Drs. 20/3068 S. 28 (Gesetzesbegründung), S. 42 (Stellungnahme des Bundesrates, unter Nr. 1) und S. 43 (Gegenäußerung der Bundesregierung, Zu Nr. 1).
Beitrag entnommen aus Bayerische Verwaltungsblätter 11/2025, S. 369.