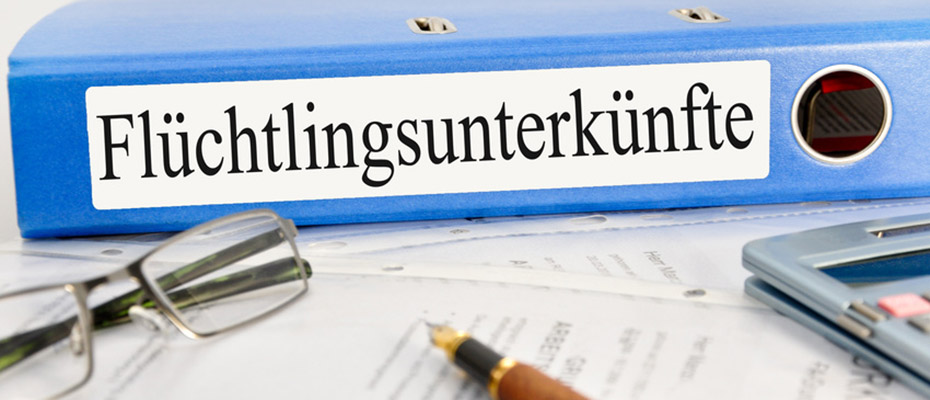Bau- und Denkmalschutzrecht zählt im Rahmen der sogenannten klassischen Rechtsgebiete des Verwaltungsrechts zu denjenigen, die in der Praxis den größten Raum einnehmen, was sich bereits daraus ablesen lässt, dass sich am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) vier Senate mit dieser Thematik befassen. Besonders bemerkenswerte Rechtsprechung des Gerichtshofs aus jüngerer Zeit wird im folgenden Beitrag (in Fortsetzung von BayVBl. 2023, 397) auszugsweise nachskizziert, wobei die Auswahl selbstverständlich subjektiv ist und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
I. Bauleitplanung
1. Bebauungsplan zur Deckung des Wohnbedarfs der örtlichen Bevölkerung
Bauleitplane sind erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB, soweit sie nach der planerischen Konzeption der Gemeinde erforderlich sind1. Hieraus ergibt sich ohne Weiteres, dass es an der gemeindlichen Planungsbefugnis fehlt, wenn die fragliche Bauleitplanung im Einzelfall offensichtlich nicht geeignet ist, das gemeindliche Planungsziel sicherzustellen. Die Sicherstellung der Erreichung der Planungsziele eines Bebauungsplans kann sich unter Umstanden auch aus einem städtebaulichen Vertrag ergeben, der diesen ergänzen soll2. Voraussetzung hierfür ist die Wirksamkeit des städtebaulichen Vertrages.
In diesem Zusammenhang hat der BayVGH3 den folgenden Fall entschieden: Der Antragsteller wendet sich gegen einen Bebauungsplan der Antragsgegnerin. Festgesetzt werden ein allgemeines Wohngebiet mit über 50 Bauparzellen für Einzel- und Doppelhäuser sowie eine Umgehungsstraße. Das überplante Gebiet liegt weitgehend im bisherigen Außenbereich. Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient laut seiner Begründung der Ausweisung von Wohnbauflachen zur Deckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung. Bereits vor der Beschlussfassung über den Bebauungsplan schloss die Antragsgegnerin, die Eigentümerin einiger weniger Flachen im Plangebiet ist, mit den beiden Eigentümern der restlichen als Bauland ausgewiesenen, deutlich überwiegenden Flachen im Plangebiet einen städtebaulichen Vertrag, in dem auf den streitgegenständlichen Bebauungsplan und dessen Planungsziele Bezug genommen wird. Damit Wohnbauland tatsachlich dem Wohnbedarf der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werde, bedürfe es eines städtebaulichen Vertrags. In diesem wird im Einzelnen geregelt, dass und wie die ortsansässige Bevölkerung für einen bestimmten Zeitraum bei der Vergabe von Wohngrundstücken zu bevorzugen ist. Eine Bevorzugung von sozial schwachen Personen wird nicht geregelt.
Der Bebauungsplan selbst enthalt keine Regelungen, die die Bevorzugung der ortsansässigen Bevölkerung bei der Vergabe von Wohnungsbaugrundstucken sicherstellen. Deshalb kam es auf den städtebaulichen Vertrag an. § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB weist auf die Möglichkeit hin, dass Gemeinden städtebauliche Verträge zum Erwerb angemessenen Wohnraums durch einkommensschwächere oder weniger begüterte Personen der örtlichen Bevölkerung abschließen können. Zwar regelt § 11 BauGB den Inhalt von städtebaulichen Verträgen nicht abschließend. Ausweislich der Begründung des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/ EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt (vgl. BR-Drs. 18/11439 S. 20), mit dem § 11 BauGB seine aktuelle Fassung, die bei Inkrafttreten des streitgegenständlichen Bebauungsplans bereits galt, erhalten hat, sollte zur Vermeidung einer europarechtswidrigen Diskriminierung auch im Wortlaut der Vorschrift hervorgehoben werden, dass Einheimischenmodelle bei europarechtskonformer Ausgestaltung dem Erwerb angemessenen Wohnraums durch einkommensschwächere und weniger begüterte Personen der örtlichen Bevölkerung dienen.
Hieraus ergibt sich ohne Weiteres der Wille des Gesetzgebers, dass die Regelungen betreffend die Bevorzugung der örtlichen Bevölkerung im Rahmen von städtebaulichen Verträgen stets auch der Berücksichtigung der genannten sozialen Komponente bedürfen, nachdem andernfalls europarechtliche Vorschriften entgegenstehen konnten. Auch mag es sich bei dem hier in Rede stehenden städtebaulichen Vertrag um einen solchen des Zivilrechts handeln.
Jedoch muss er sich, nachdem eine Kommune Vertragspartner ist und er der Erfüllung von bauleitplanerischen Zielsetzungen dient, am Vorrang des Gesetzes messen lassen, sodass er aufgrund des Verstoßes gegen § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 letzte Alt. BauGB in entsprechender Anwendung von Art. 59 Abs. 1 BayVwVfG jedenfalls in der Frage der Bevorzugung von Einheimischen nichtig ist4.
Da somit weder durch den Bebauungsplan selbst noch durch den städtebaulichen Vertrag die Erreichung der genannten Planungsziele sichergestellt ist, fehlte es der Planung an der notwendigen Erforderlichkeit im Sinn von § 1 Abs. 3 BauGB. Folge einer fehlenden Erforderlichkeit und damit Planungsbefugnis im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 ist auch unter Berücksichtigung der Vorschriften der §§ 214 f. BauGB die Unwirksamkeit des Bauleitplans5. Deshalb konnte die Frage offenbleiben, ob eine zulässige Regelung der Bevorzugung von Einheimischen im städtebaulichen Vertrag ausgereicht hatte, um das Planungsziel des Bebauungsplans sicherzustellen6.
2. Besonderheiten des Abwägungsgebots und der städtebaulichen Erforderlichkeit beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Die Abwägung ist das Kernstuck eines jeden Bauleitplans und lasst sich der Begründung und den Aufstellungsunterlagen – insbesondere den Beschlussvorlagen bei der Entscheidung über die eingegangenen Stellungnahmen – entnehmen. Mangel im Abwägungsvorgang sind nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind7. Die Grundsätze der Abwägungsfehlerlehre gelten auch beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan8. Die durch § 12 Abs. 3a BauGB eröffnete Möglichkeit, für das den Gegenstand des Vorhaben- und Erschließungsplans bildende Vorhaben einen größeren rechtlichen Rahmen zu schaffen, ist ein Einfallstor für leicht zu übersehende Abwägungsfehler9.
Der BayVGH10 hat in diesem Zusammenhang einen Bebauungsplan gemäß § 47 Abs. 6 VwGO außer Vollzug gesetzt, der für das Plangebiet unter anderem ein allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO festsetzte. Ausgeschlossen wurden in den textlichen Festsetzungen nur die nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen, so dass der Rechtsplan die allgemeine Zweckbestimmung eines allgemeinen Wohngebiets wahrte11. Gleichzeitig setzte der Bebauungsplan allerdings gemäß § 12 Abs. 3a Satz 1 BauGB unter Bezugnahme auf § 9 Abs. 2 BauGB fest, dass im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung der Vorhabenträger sich verpflichtet hat. Im Durchführungsvertrag wird die in dem relevanten Planbereich zulässige Nutzung ausschließlich auf Wohngebäude beschränkt, was mit den Darstellungen im Vorhaben- und Erschließungsplan korrespondierte.
Der Senat nahm in diesem Zusammenhang einen „Etikettenschwindel“ mit der Folge der fehlenden Erforderlichkeit der Planung gemäß § 1 Abs. 3 BauGB an. Denn nach der Systematik des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind Vorhaben, die vom vorhabenbezogenen Bebauungsplan, nicht aber vom Durchführungsvertrag erfasst werden, unzulassig12, was unter Berücksichtigung des Durchführungsvertrags dazu führe, dass auch Vorhaben nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauGB ausgeschlossen seien. Wenn der Plangeber die Realisierung von im allgemeinen Wohngebiet neben dem Wohnen allgemein zulässigen Nutzungen gar nicht anstrebe oder wenn eine solche Entwicklung wegen der vorhandenen Bebauung oder aufgrund sonstiger Festsetzungen im Bebauungsplan faktisch nicht zu erreichen sei, stelle die Festsetzung des allgemeinen Wohngebiets einen städtebaulich nicht gerechtfertigten „Etikettenschwindel“ dar13.
II. Bauplanungsrecht
1. Rücksichtnahmegebot
a) Unzulässigkeit einer Asylbewerberunterkunft im allgemeinen Wohngebiet im Einzelfall
Liegt ein Vorhaben im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans, ist es zulässig, wenn es den Festsetzungen nicht widerspricht (§ 30 Abs. 1 BauGB). Ausnahmsweise kann sich aufgrund von § 15 BauNVO (Gebot der Rücksichtnahme) eine Unzulässigkeit im Einzelfall ergeben. Nach Satz 1 der Vorschrift sind an sich zulässige Anlagen im Einzelfall unzulässig, wenn sie nach Anzahl, Lage, Umfang oder Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebiets widersprechen. Diese Voraussetzungen liegen etwa vor, wenn ein nach Art und Maß der baulichen Nutzung grundsätzlich zulässiger Gewerbebetrieb wegen seiner Betriebsgröße der Eigenart des Baugebiets widerspricht, eine besondere große Vergnügungsstätte den Charakter des Gebiets verändert oder wenn ein Warenhaus wegen seiner Größe die Verkehrsverhältnisse des Baugebiets nachhaltig beeinflusst14. Die Vorschrift wurde jetzt auch vom BayVGH15 bemüht, um in einem Eilverfahren die Unzulässigkeit einer Asylbewerberunterkunft im allgemeinen Wohngebiet im Einzelfall zu begründen.
Die Gemeinschaftsunterkunft soll auf zwei Grundstücken des beigeladenen Landkreises errichtet werden. Als Bestand befindet sich dort ein größeres Wohngebäude, das bereits als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge genutzt wird. Diese soll mit dem Bauvorhaben in Modulbauweise für 96 Bewohner erweitert werden. Der etwa 49 m lange Baukörper ist entlang der südlichen Grundstücksgrenze situiert. Die Antragsteller sind Miteigentümer des unmittelbar daran angrenzenden Grundstückes, das mit einem Einfamilienhaus bebaut ist. Der Vorhabenstandort liegt im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der für das Plangebiet ein allgemeines Wohngebiet festsetzt; die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind ausgeschlossen.
Im Unterschied zur ersten Instanz ging der Senat von einer Verletzung des Rücksichtnahmegebots aus: „Die genehmigte Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge für 96 Personen übt eine dominierende, den Charakter des Gebietes verändernde Wirkung aus (vgl. BVerwG, B.v. 29.07.1991 – 4 B 40.91 – NVwZ 1991, 1078). Das kleine Baugebiet weist neben den Grundstücken der Beigeladenen zu 1 eine aufgelockerte Bebauung mit Einfamilienhäusern und Doppelhäusern auf, auch im Hinblick auf das festgesetzte zulässige Maß der baulichen Nutzung sind hier größere Veränderungen auf den Wohngrundstücken nicht zu erwarten, gegebenenfalls kann auf dem Grundstück Flur- Nr. 2 ein zusätzliches Gebäude errichtet werden. Bei der genehmigten Gemeinschaftsunterkunft handelt es sich hingegen sowohl nach der Kubatur als auch nach der Belegungszahl um eine größere Anlage. Zudem dürfte das nach den Angaben der Beteiligten bereits als Gemeinschaftsunterkunft genutzte Gebäude auf dem Grundstück Flur-Nr. 2 mit zu berücksichtigen sein, gegen eine Mitberücksichtigung werden im Beschwerdeverfahren keine Einwände geltend gemacht. Konkretere Angaben hierzu werden im Klageverfahren zu ermitteln sein. Mit der Größe der Unterkunft beziehungsweise deren Belegungszahl erhöhen sich erfahrungsgemäß die Lärmimmissionen. So wird auch in der immissionsschutzfachlichen Stellungnahme zum Bauvorhaben darauf hingewiesen, dass es bei Bauvorhaben dieser Größenordnung zu Lärmkonflikten mit der Nachbarschaft kommen kann. Die bestehende räumliche Enge in der Flüchtlingsunterkunft (sehr kleine Zimmer und begrenzte Aufenthaltsmöglichkeiten in den Gemeinschaftsräumen) wird dazu führen, dass sich die Bewohner in größerer Zahl im Freien vor der Unterkunft aufhalten, sei es noch auf den Vorhabengrundstücken, die bereits relativ dicht bebaut sind, oder den benachbarten Straßen- oder Grünflächen im Plangebiet. Dies ist ebenfalls geeignet, eine Unruhe in das Gebiet zu bringen (vgl. OVG Hamburg, B.v. 28.05.2015 – 2 Bs 23/15 – ZfBR 2016, 61), die mit dem Wohncharakter in dem kleinen Gebiet nicht mehr vereinbar ist. Da es auf das Maß der baulichen Nutzung nicht ankommt (vgl. BVerwG, U.v. 16.03.1995 – 4 C 3.94 – NVwZ 1995, 899), weist der Senat hier nur darauf hin, dass das Landratsamt bei der Genehmigung der Gemeinschaftsunterkunft zu Unrecht von einem zulässigen Maß der baulichen Nutzung ausgegangen ist. Die auf dem Grundstück Flur-Nr. 2 festgesetzte private Grünfläche stellt kein Bauland dar und kann bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche nicht berücksichtigt werden, weiter kann nur die innerhalb des Plangebiets liegende Grundstücksfläche berücksichtigt werden. Soweit der Antragsgegner geltend macht, dass die Unterbringung von Asylbewerbern zu den Nutzungen gehört, die dem Wohnen ähnlich sind, ist dies zwar grundsätzlich richtig, es gibt aber auch hier unterschiedliche Unterbringungsformen (vgl. BVerwG, U.v. 17.12.1998 – 4 C 16.97 – BVerwGE 108, 190). Es handelt sich bei der genehmigten Gemeinschaftsunterkunft nicht um eine Unterbringung in einem bestehenden Wohngebäude oder in einzelnen, kleineren Wohncontainern, sondern um eine Unterbringung in einem größeren, lang gestreckten Gebäude in Modulbauweise, bei der die Unterbringung einer möglichst großen Zahl von Flüchtlingen im Vordergrund steht. Eine einzelfallbezogene Prüfung im Rahmen des § 15 Abs. 1 Satz 1 BauGB wird auch durch die gesetzgeberische Wertung in § 246 Abs. 11 BauGB, auf die sich der Antragsgegner bezogen hat, nicht obsolet. Ob eine Befristung der Nutzung im Rahmen des § 15 Abs. 1 Satz 1 BauGB berücksichtigt werden kann, kann vorliegend dahingestellt bleiben, da jedenfalls eine Befristung auf zwölf Jahre nicht geeignet ist, die Schutzwürdigkeit des Wohngebiets zu relativieren.“
b) Erdrückende Wirkung eines Bauvorhabens
Nachbarschutz aus dem Gebot der Rücksichtnahme setzt stets einen Verstoß gegen das objektive Recht voraus. Das Gebot der Rücksichtnahme beschränkt sich nicht auf den Schutz vor Immissionen, sondern erfasst auch andere Formen der Beeinträchtigung von Nachbargrundstücken, soweit sie städtebauliche Relevanz haben. Es setzt aber voraus, dass der Konflikt im Bebauungsplan nicht bereits abschließend (in rechtlich zulässiger Weise) abgewogen und bewältigt worden ist. Da sich im Bereich der Immissionen Abwehrrechte des Nachbarn ohnehin aus dem Fachrecht ergeben, sind die anderweitigen Formen von Beeinträchtigungen praktisch wichtiger. Dabei geht es in der Praxis auch um erdrückende Wirkungen von baulichen Anlagen, auch Einmauerungseffekte genannt16. Für diese Fallkonstellation kommt es stets darauf an, ob die tatsächlichen Auswirkungen das Maß des im Baugebiet Zumutbaren überschreiten. Allerdings hat das häufige Vorbringen, Nachbar-Bauvorhaben hätten eine „erdrückende“ Wirkung, im Klageverfahren meist keinen Erfolg. Bei Einhaltung der landesrechtlichen Abstandsvorschriften ist die Annahme einer „erdrückenden Wirkung“ nur in Ausnahmefällen möglich. Eine erdrückende Wirkung und damit zugleich ein Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme ist nur dann anzunehmen, wenn eine bauliche Anlage wegen ihrer Ausmaße, ihrer Baumasse oder ihrer massiven Gestaltung ein benachbartes Grundstück unangemessen benachteiligt, indem es diesem förmlich „die Luft nimmt“, weil für den Nachbarn das Gefühl „des Eingemauertseins“ entsteht. Für die Annahme der „erdrückenden Wirkung“ eines Nachbargebäudes ist in der Regel kein Raum, wenn dessen Baukörper nicht erheblich höher ist als das betroffene Gebäude. Die „Masse“ eines Vorhabens als solche entfaltet keine erdrückende Wirkung. Etwas anderes gilt, wenn die genehmigte Anlage das Nachbargrundstück regelrecht abriegelt, also dort ein Gefühl des Eingemauertseins oder eine Gefängnishofsituation hervorruft. Hierauf hat der BayVGH17 in folgendem Fall letztlich abgehoben:
Die Klägerin wendet sich als Nachbarin gegen die der Beigeladenen erteilte Baugenehmigung zur Errichtung eines Wohngebäudes in einer engen Hinterhoflage. Erstinstanzlich obsiegte sie. Der Antrag der Beigeladenen auf Zulassung der Berufung blieb ohne Erfolg. In seinem Beschluss führt der Senat auszugsweise Folgendes aus: „Grundsätzlich kann als Gradmesser für die Intensität der Beeinträchtigung des Nachbarn herangezogen werden, ob die bauliche Anlage dadurch dem klägerischen Wohngebäude buchstäblich die letzte Luft zum Atmen nimmt, dass sie auch die letzte noch freie Seite verschließt (vgl. BayVGH, B.v. 16.10.2007 – 1 CS 07.1848 – juris Rn. 40). Bei der Abwägung, wann eine solche abriegelnde Wirkung anzunehmen ist, und dessen, was dem Nachbarn oder dem Bauherrn billigerweise zugemutet werden kann, erscheint der Nachbar, der von allen Seiten durch heranrückende Bebauung betroffen ist, schutzwürdiger als ein Nachbar, dessen Grundstück noch in zwei Himmelsrichtungen nicht durch weiter herangerückte Bebauung beeinträchtigt ist (vgl. BayVGH, B.v. 25.05.2021 – 15 ZB 20.2128 – juris Rn. 16; Troidl, Erdrückende Wirkung im öffentlichen Baurecht, BauR 2008, 1843). Hier würde das Bauvorhaben dazu führen, dass der klägerische Innenhof von allen Seiten umschlossen wäre, da der bislang freie Durchgang zwischen dem bestehenden Querbau und dem Rückgebäude wegfallen soll. Zudem hat das Verwaltungsgericht zu Recht in seine Erwägung miteinbezogen, dass die östliche Außenwand des geplanten Rückgebäudes nach Osten versetzt wird, weil diese Verschiebung der Ostwand des Rückgebäudes, gerade auch im Zusammenspiel mit der deutlichen Erhöhung dieser Wand von circa 10 m auf 17,10 m und dem bis zum Rückgebäude durchgezogenen Querbau – wie auf dem als ‚Vogelperspektive Süd‘ bezeichneten Plan gut zu erkennen ist –, zu einer deutlichen Verengung der Innenhofsituation zulasten des Klägers führt. Hier – wie seitens der Beigeladenen erfolgt – nur auf die Situierung der östlichen Außenwand des Rückgebäudes abzustellen, greift zu kurz.“
2. Sozialadäquanz von Kindergartenlärm
Kindergartenlärm ist grundsätzlich als sozialadäquat hinzunehmen, wie zwei Nachbarn im folgenden Fall erfahren mussten: Sie wenden sich gegen eine der Beklagten erteilte Baugenehmigung für den Umbau und die Nutzungsänderung eines Wohnhauses in einen Kindergarten auf dem Nachbargrundstück. In unmittelbarer Nähe des klägerischen Grundstücks befindet sich bereits ein weiterer Kindergarten, in der näheren Umgebung findet sich eine Schule. Die Kläger meinten, durch den jetzt genehmigten Kindergarten würden insgesamt unzumutbare Immissionen auf ihr Grundstück einwirken. Erstinstanzlich obsiegten sie. In der Berufungsinstanz hob der BayVGH18 die erstinstanzliche Entscheidung auf und wies die Klage ab. Zunächst verneinte er einen Verstoß gegen den Gebietserhaltungsanspruch19:
„Ein Verstoß gegen einen etwaigen Gebietserhaltungsanspruch ist nicht ersichtlich. Der Gebietserhaltungsanspruch des Nachbarn setzt voraus, dass das Grundstück in einem festgesetzten oder in einem faktischen Baugebiet (§ 34 Abs. 2 BauGB) liegt, und ist im Ergebnis darauf gerichtet, Vorhaben zu verhindern, die nach Art der baulichen Nutzung weder regelmäßig noch ausnahmsweise in diesem Gebiet zulässig sind (vgl. BVerwG, U.v. 16.09.1993 – 4 C 28.91 – juris Rn. 13). Dieser bauplanungsrechtliche Nachbarschutz beruht auf dem Gedanken des wechselseitigen Austauschverhältnisses. Im Rahmen dieses nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnisses kann daher das Eindringen einer gebietsfremden Nutzung und damit die schleichende Umwandlung des (faktischen) Baugebiets unabhängig von einer konkreten Beeinträchtigung verhindert werden (vgl. BVerwG, B.v. 22.12.2011 – 4 B 32.11 – ZfBR 2012, 378). Mit dem Erstgericht ist davon auszugehen, dass es sich bei dem maßgeblichen Quartier um ein faktisches allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) handelt, in dem Kindergärten als Anlagen für soziale Zwecke allgemein zulässig sind (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO). Diese Einschätzung des Erstgerichts wird von den Beteiligten auch nicht infrage gestellt. Ob aufgrund des bestehenden Kindergartens S in der unmittelbaren Umgebung überhaupt weiterer Bedarf an Kinderbetreuungsmöglichkeiten besteht, ist, wovon das Erstgericht ebenfalls zutreffend ausgeht, entgegen der Ansicht der Kläger nicht entscheidend. Auf den nur der Versorgung des Gebiets dienenden Charakter der Anlage kommt es im Rahmen von § 4 Abs. 2 BauNVO nicht an. Diese Einschätzung des Erstgerichts wurde von den Klägern im Berufungsverfahren auch nicht weiter angegriffen.“
Weiter verneinte er einen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot20: „Es kann dahinstehen, ob sich dieses im vorliegenden Fall aus dem Begriff des ‚Einfügens‘ des § 34 Abs. 1 BauGB oder aus § 34 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 15 Abs. 1 BauNVO ableitet, da im Ergebnis dieselbe Prüfung stattzufinden hat (vgl. BayVGH, B.v. 05.12.2012 – 2 CS 12.2290 – juris Rn. 3). Inhaltlich zielt das Gebot der Rücksichtnahme darauf ab, Spannungen und Störungen, die durch unverträgliche Grundstücksnutzungen entstehen, möglichst zu vermeiden. Welche Anforderungen das Gebot der Rücksichtnahme begründet, hängt wesentlich von den jeweiligen Umständen des Einzelfalles ab. Für eine sachgerechte Bewertung des Einzelfalles kommt es wesentlich auf eine Abwägung zwischen dem, was einerseits dem Rücksichtnahmebegünstigten und andererseits dem Rücksichtnahmeverpflichteten nach Lage der Dinge zumutbar ist, an (vgl. BVerwG, U.v. 18.11.2004 – 4 C 1.04 – juris Rn. 22; U.v. 29.11.2012 – 4 C 8.11 – juris Rn. 16; BayVGH, B.v. 12.09.2013 – 2 CS 13.1351 – juris Rn. 4). Bedeutsam ist ferner, inwieweit derjenige, der sich gegen das Vorhaben wendet, eine rechtlich geschützte wehrfähige Position innehat (vgl. BVerwG, B.v. 06.12.1996 – 4 B 215.96 – juris Rn. 9). Eine Rechtsverletzung ist erst dann zu bejahen, wenn von dem Vorhaben eine unzumutbare Beeinträchtigung ausgeht (vgl. BayVGH, B.v. 22.06.2011 – 15 CS 11.1101 – juris Rn. 17). Eine unzumutbare Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks durch die (hinzukommende) Kindertagesstätte ist nicht zu erwarten. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die durch die bestimmungsgemäße Nutzung der Kindertagesstätte verursachten Geräuscheinwirkungen sowie den durch den An- und Abfahrtsverkehr verursachten Lärm.“
Schließlich wies er darauf hin, dass Kindergartenlärm grundsätzlich als sozialadäquat hinzunehmen ist: „Hinsichtlich der durch die Kinder verursachten Geräusche – insbesondere bei Nutzung des rückwärtigen Gartenbereichs des Vorhabengrundstücks als Außenspielfläche – folgt dies schon aus § 22 Abs. 1a BImSchG.
Nach dieser Regelung sind Geräuscheinwirkungen, die unter anderem von Kindertageseinrichtungen durch Kinder hervorgerufen werden, im Regelfall keine schädlichen Umwelteinwirkungen (vgl. BVerwG, B.v. 05.06.2013 – 7 B 1.13 – juris Rn. 6). Bei der Beurteilung der Geräuscheinwirkungen dürfen Immissionsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen werden. Ziel dieser Regelung ist es, das Lärmschutzrecht dahingehend weiter zu entwickeln, um den von Kindertageseinrichtungen ausgehenden ‚Kinderlärm‘ zu privilegieren und um ein klares gesetzgeberisches Signal für eine kinderfreundliche Gesellschaft zu setzen (BT-Drs. 17/4836; vgl. auch Art. 2 BayKJG, wonach die natürlichen Lebensäußerungen von Kindern, die Ausdruck natürlichen Spielens oder anderer kindlicher Verhaltensweisen sind, als sozialadäquat hinzunehmen sind).
Die Privilegierung betrifft grundsätzlich ‚Geräuscheinwirkungen‘ durch Kinder sowie das Rufen und Sprechen von Betreuungspersonen und das Nutzen kindgerechter Spielgeräte (vgl. BVerwG, B.v. 05.06.2013 – 7 B 1.13 – juris Rn. 6).Der mit dem Betrieb eines Kindergartens einhergehende Lärm ist in Gebieten, in denen eine solche Einrichtung nach den Regelungen der BauNVO zur Art der baulichen Nutzung regelmäßig oder ausnahmsweise zulässig ist – so auch in (faktischen) reinen und allgemeinen Wohngebieten und in Mischgebieten gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2, § 4 Abs. 2 Nr. 3, § 6 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO (ggf. i.V. mit § 34 Abs. 2 BauGB) bzw. in unbeplanten Gemengelagen mit tatsächlich vorhandener Wohnnutzung gemäß § 34 Abs. 1 BauGB – grundsätzlich von den Nachbarn hinzunehmen (vgl. BayVGH, B.v. 12.02.2020 – 15 CS 20.45 – juris Rn. 17).“
III. Denkmalschutzrecht
1. Rückbau von Bausünden, die (angeblich) schon vor einer Unterschutzstellung durch das Denkmalschutzgesetz begangen worden sind
In diesem Verfahren21 ging es um ein ehemaliges Schlossbrauhaus aus dem frühen 18. Jahrhundert, das in einem malerischen Schlossensemble der mittelfränkischen Gemeinde H liegt. Es ist wie folgt in die Denkmalliste eingetragen: „Ehemaliges Schlossbrauhaus, erdgeschossiger Sandsteinquaderbau mit mächtigen Walmdach, Ecklisenen und Zwerchhaus mit Satteldach, 1. Hälfte 18. Jahrhundert.“ In das „mächtige Walmdach“ hatte der Kläger moderne Dachflächenfenster eingebaut. Streitig war, ob diese Fenster bereits vor der denkmalrechtlichen Unterschutzstellung des Gebäudes oder erst danach eingebaut worden waren. Im Jahr 2018 verpflichtete die Untere Denkmalschutzbehörde den Kläger, die Dachflächenfenster in seinem Anwesen zurückzubauen. Eine Erlaubnis für deren Einbau sei nicht beantragt worden und könne auch nicht erteilt werden. Die hiergegen erhobene Klage blieb in beiden Instanzen erfolglos:
„Soweit der Kläger gleichwohl der Auffassung ist, das Denkmalschutzgesetz finde im vorliegenden Fall keine Anwendung, weil der Einbau der streitgegenständlichen Dachflächenfenster bereits vor dem Jahr 1970 und damit vor dessen Inkrafttreten stattgefunden habe und deshalb keiner Erlaubnis nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 DSchG bedürfe, verhilft dies seiner Berufung nicht zum Erfolg. Zwar ist rechtlich nicht eindeutig geklärt, ob auf der Grundlage von Art. 15 Abs. 4 DSchG auch der Rückbau solcher Bausünden verlangt werden kann, die schon vor einer Unterschutzstellung durch das Denkmalschutzgesetz begangen worden sind und ob insoweit über den reinen Bestandsschutz hinaus auch eine denkmalpflegerisch wünschenswerte Verbesserung durch Herstellung eines dem historischen Original angenäherten Zustands, der aber zur Zeit der Unterschutzstellung bereits nicht mehr bestand, gefordert werden darf (bejahend: Eberle/Spennemann/ Schindler-Friedrich/Gerstner, Bayerisches Denkmalschutzgesetz, 8. Aufl. 2021, Art. 6 Rn. 75; in diese Richtung wohl auch: BayVGH, U.v. 06.11.1994 – 2 B 94.2926 n.v.; U.v. 09.08.1996 – 2 B 94.3022 – BayVBl. 1997, 633; ablehnend, allerdings zur dortigen Rechtslage: OVGBbg, U.v. 20.11.2002 – 3 A 248/99 – juris Rn. 24). Die aufgeworfene Frage bedarf indes hier keiner abschließenden Entscheidung. Was die im zweiten Dachgeschoss eingebaute Fensterreihe betrifft, behauptet bereits der Kläger selbst nicht, dass diese aus einer Zeit vor dem Inkrafttreten des Denkmalschutzgesetzes stamme. Vielmehr wurden diese Fenster, wie sich aus den vom Beklagten in der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Senat übergebenen und zu den Akten genommenen Lichtbildern unzweifelhaft ergibt, zwischen dem 20. April 2011 und dem 25. April 2016 eingebaut.
Aber auch im Hinblick auf die offenbar bereits zu einem früheren Zeitpunkt im ersten Dachgeschoss unmittelbar neben den historischen Dachgauben eingebauten Liegefenster hält es der Senat nach Durchführung des Berufungsverfahrens für erwiesen, dass diese – entgegen der Behauptung des Klägers – ebenfalls nicht aus einer Zeit vor dem Inkrafttreten des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes im Jahr 1973 stammen, sondern erst deutlich später, vermutlich in den 1980iger Jahren und damit unter Geltung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes, eingebaut wurden. Dies ergibt sich aus den vom Beklagten im Lauf des Verfahrens nachgereichten Akten: Ausweislich dieser Akten wurde dem (oder einem der) Rechtsvorgänger des Klägers mit Bescheid vom 20. Januar 1983 die Genehmigung für Umbauarbeiten an dem streitgegenständlichen Anwesen erteilt.
Beantragt und genehmigt wurden ein Kamineinbau, der Einbau eines Dacherkers und die Neudeckung der Dachfläche sowie die Errichtung einer Garage. In den entsprechenden Planunterlagen der Gebäudeansicht ist – worauf der Beklagte zutreffend hingewiesen hat – kein einziges Dachflächenfenster eingezeichnet. Lediglich im Grundriss des ausgebauten Dachgeschosses ist ein ‚Velux-Dach-Fenster‘ erkennbar, das aber insoweit im Widerspruch zur vorgelegten Gebäudeansicht steht und auch nicht vom Genehmigungsbescheid umfasst ist. Zwar bedeutet dies entgegen der Ansicht des Beklagten nicht notwendigerweise, dass die Dachflächenfenster im ersten Dachgeschoss tatsächlich anlässlich dieser Baumaßnahme eingebaut worden sind. Fest steht angesichts dessen aber, dass sie vor dem Jahr 1983 noch nicht vorhanden waren. Letzteres ergibt sich auch aus dem vom Beklagten in der mündlichen Verhandlung am 30. Juni 2023 vorgelegten Akt, in den der Senat und sämtliche Beteiligten Einsicht genommen haben. In ihm befindet sich ein Schreiben des zuständigen Landratsamts vom 27. März 1984, das eine mögliche Genehmigung von Werbeanlagen auf dem Anwesen des Klägers zum Gegenstand hat. Dem Schreiben waren Fotos des streitgegenständlichen Gebäudes und der Werbeanlagen beigefügt, auf denen auch zum Zeitpunkt von deren Errichtung keine Dachflächenfenster, sondern ausschließlich die ursprünglichen Dachgauben erkennbar sind. Im Übrigen finden sich in den Behördenakten weitere, vom damaligen Eigentümer für andere Vorhaben eingereichte Pläne, die im Dezember 1981 sowie im April 1984 von einem Konstruktionsbüro gefertigt wurden. Die jeweiligen Gebäudeansichten weisen ebenfalls keine Dachflächenfenster auf.“
Interessant ist vor allem die Frage, auf die es im Verfahren nicht mehr ankam: Kann vom Eigentümer eines Denkmals verlangt werden, dass Veränderungen an dem Bauwerk zurückgebaut werden, wenn diese bereits zu einem Zeitpunkt erfolgt sind, bevor die Denkmaleigenschaft überhaupt begründet worden ist? Auf den ersten Blick wohl nicht: Ein Baudenkmal ist grundsätzlich in dem Bestand geschützt, den es im Laufe seiner Geschichte gefunden hat. Gerade die Ablesbarkeit der geschichtlichen Veränderungen kann die Denkmaleigenschaft begründen oder verstärken. Außerdem könnte möglicherweise die Einstufung eines solchen Verlangens als „echte Rückwirkung“ – vor allem dort, wo die Eintragung in die Denkmalliste im Unterschied zur bayerischen Rechtslage konstitutiv ist – verfassungsrechtliche Bedenken auslösen22.
2. Maßgeblichkeit der Einschätzung der Fachbehörde
Der Antragsteller und der Beigeladene sind Eigentümer von benachbarten Baudenkmälern (Schloss und Burg T). Mit Bescheid vom 6. Oktober 2022 wurde dem Beigeladenen die Baugenehmigung für die Errichtung einer altersgerechten Wohnung auf dem Vorhabengrundstück im Innenhof des aus Burg und Schlossanlagen bestehenden Ensembles erteilt. Hiergegen wendet sich der Antragsteller mit der Begründung, das Vorhaben beeinträchtige sein eigenes Denkmal. Im einstweiligen Rechtsschutzverfahren unterlag er in beiden Instanzen. Das Landesamt für Denkmalpflege hatte zu dem streitgegenständlichen Vorhaben dahingehend Stellung genommen, dass sich das kleine Gebäude als Nebengebäude mit seiner Kubatur und seinen architektonischen Formen ohne nennenswerte Beeinträchtigung für das Baudenkmal in den Hofraum einfüge. Diese fachliche Einschätzung sah der BayVGH23 durch das Beschwerdevorbringen nicht erschüttert:
„Das Landesamt für Denkmalpflege ist die zur fachlichen Einschätzung des Denkmalwerts eines Baudenkmals und seiner Beeinträchtigung nach Art. 12 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 3 Nr. 5 DSchG berufene Fachbehörde. Auch wenn die Baugenehmigungsbehörden und die Gerichte rechtlich nicht an die fachliche Beurteilung des Landesamtes gebunden sind, sondern vielmehr deren Aussage- und Überzeugungskraft nachvollziehend zu überprüfen und sich aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens eine eigene Überzeugung zu bilden haben, kommt den fachlichen Einschätzungen der Fachbehörde – ähnlich einem fachkundig erstellten Sachverständigengutachten – auch aufgrund der gesetzlichen Wertung des Art. 12 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 3 Nr. 5 BayDSchG bei der Rechtsanwendung jedenfalls ein besonderes tatsächliches Gewicht zu (BayVGH, U.v. 26.10.2021 – 15 B 19.2130 – juris Rn. 34; U.v. 18.07.2013 – 22 B 12.1741 – BayVBl. 2014, 23, juris Rn. 27; U.v. 25.06.2013 – 22 B 11.701 – BayVBl. 2014, 502, juris Rn. 33). Um bereits vorliegende fachkundige Stellungnahmen inhaltlich zu erschüttern, bedarf es eines substantiierten Vorbringens, weshalb sich die fachkundige amtliche Aussage im Sinn von § 98 VwGO i. V. m. § 412 Abs. 1 ZPO als ungenügend darstellt.
Ungenügend sind Auskünfte und Gutachten insbesondere dann, wenn sie erkennbare Mängel aufweisen, etwa unvollständig, widersprüchlich oder sonst nicht überzeugend sind, wenn die fachkundige Äußerung von unzutreffenden tatsächlichen Voraussetzungen ausgeht oder wenn der Gutachter erkennbar nicht sachkundig ist bzw. Zweifel an seiner Unparteilichkeit bestehen (vgl. BVerwG, B.v. 28.07.2022 – 7 B 15.21 – juris Rn. 26).
Indem der Antragsteller geltend macht, durch das beabsichtigte Bauvorhaben komme es zu einer Beeinträchtigung des Wesens, des ‚überliefernden Erscheinungsbilds und der künstlerischen Wirkung des Baudenkmals‘ und die Zerstörung des Ensembles bzw. der zusammengehörigen Sichtachsen sei von der Fachbehörde falsch gewürdigt worden, stellt er der fachlichen Stellungnahme des Landesamtes lediglich seine abweichende Auffassung gegenüber. Auch angebliche Beeinträchtigungen der historischen Gänge des Schlosses zur Burg durch das Vorhaben werden von ihm ohne nähere Substantiierung lediglich behauptet. Dies vermag die fachkundige Einschätzung, wonach keine nennenswerte Beeinträchtigung des Baudenkmals durch das Vorhaben vorliegt, nicht infrage zu stellen. Eine tatsächlich drohende Zerstörung unterirdischer Gänge erscheint auch insofern nicht plausibel, als das genehmigte Vorhaben nicht unterkellert ist und unter Erhalt der Bodenplatte des vormals an dieser Stelle befindlichen, größeren Gebäudes (‚…‘) errichtet werden soll.“
IV. Verfahrensfragen und Prozessuales
1. Fiktion des gemeindlichen Einvernehmens bei fehlerhafter Fristangabe im Ersuchen
Nach § 246 Abs. 15 BauGB gilt abweichend von § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB das Einvernehmen als erteilt, wenn es nicht innerhalb eines Monats verweigert wird. Ziel dieser Regelung ist die Verfahrensbeschleunigung. Erfasst werden alle Baugenehmigungen, die vor dem31.Dezember 2024 erteilt werden und der Unterbringung von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden dienen, auch wenn dabei von den Sonderregelungen der Absätze 8 bis 13 kein Gebrauch gemacht wird. Abgesehen von der auf einen Monat verkürzten Frist für die Einvernehmenserteilung bleiben die sonstigen dafür bestehenden Anforderungen unverändert. Dies gilt insbesondere für den Beginn der Frist und Ersetzungsmöglichkeit24. Entschieden war bislang nur, dass die Frist auch ausgelöst wird, wenn im Ersuchen zu Unrecht eine kürzere Frist genannt wird25.
Den umgekehrten Fall hatte der BayVGH26 zu entscheiden. Die Genehmigungsbehörde teilte der Gemeinde im Ersuchen mit, die Frist betrage zwei Monate. Es ging um einen Bauantrag für die Umnutzung und den teilweisen Umbau vorhandenen Bestandes in eine Flüchtlingsunterkunft. Mitbeantragt war noch eine anderweitige Umnutzung, die aber im Einklang mit dem vorhandenen Bebauungsplan stand und vor diesem Hintergrund nicht einvernehmensbedürftig war. Der Senat stellte sich auf den Standpunkt, dass in diesem Fall die Frist nicht ausgelöst werde: „Eine Einvernehmensfiktion nach § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB i. V. m. § 246 Abs. 15 BauGB ist bei summarischer Prüfung vorliegend gleichwohl nicht eingetreten, da es an einem ordnungsgemäßen Ersuchen des Landratsamtes im Sinn von § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB fehlt. Da § 246 Abs. 15 BauGB hinsichtlich des Fristbeginns keine (abweichende) Regelung trifft, richtet sich dieser nach § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB. Vorliegend bedurfte es zur Auslösung der verkürzten Monatsfrist des § 246 Abs. 15 BauGB nach § 36 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB eines an die Antragstellerin gerichteten Ersuchens des Landratsamts, da der Bauantrag gemäß § 8 Satz 1 DBauV in der bis zum 31. Dezember 2024 geltenden Fassung abweichend von Art. 64 Abs. 1 BayBO in der bis zum 31. Dezember 2024 geltenden Fassung bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen war.
Ein ordnungsgemäßes Ersuchen im Sinn von § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB muss in Anbetracht der weitreichenden Folgen der Zustimmungsfiktion aus Gründen der Rechtssicherheit eindeutig als solches formuliert sein; maßgeblich ist insoweit der Empfängerhorizont der Gemeinde. Diese muss erkennen können, dass und in welcher Hinsicht die gegebenenfalls eine Fiktionswirkung auslösende Frist in Gang gesetzt wird (vgl. OVG NW, U.v. 09.05.2014 – 8 A 432/12 – juris Rn. 70). Unter Berücksichtigung dieser Maßgaben stellt das Schreiben des Landratsamts vom 6. November 2024, in dem die Antragstellerin um Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB bis zum 7. Januar 2025 gebeten wurde mit dem Hinweis darauf, dass das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB als erteilt gelte, wenn es nicht innerhalb der oben genannten Frist verweigert werde, kein ordnungsgemäßes Ersuchen dar. Denn die erfolgte ‚Setzung‘ einer Zweimonatsfrist nach § 36 Abs. 2 Abs. 2 BauGB statt der tat- sächlich einschlägigen Monatsfrist des § 246 Abs. 15 BauGB erzeugte bei der Antragstellerin einen Irrtum über die maßgebliche Einvernehmensfrist, der dazu führte, das die Antragstellerin die am 3. Dezember 2024 vom Bauausschuss beschlossene Versagung des gemeindlichen Einvernehmens dem Landratsamt erst am 20. Dezember 2024 – nach einer Befassung des Stadtrates mit dem Vorgang in der Sitzung am 17. Dezember 2024 und Inkrafttreten der Veränderungssperre am 19. Dezember 2024 – mitteilte. Nach Auffassung des Senats war die fehlerhafte ‚Fristsetzung‘ im Ersuchen des Landratsamts nach den Umständen des vorliegenden Falles – anders als etwa in dem dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. August 2020 (4 C 1.19 – juris Rn. 14) zugrunde liegenden Sachverhalt – bei summarischer Prüfung auch objektiv geeignet, bei der Antragstellerin einen entsprechenden Irrtum über die maßgebliche Einvernehmensfrist hervorzurufen, nachdem es sich bei der Zweimonatsfrist nach § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB um den Regelfall der Einvernehmensfrist handelt und hinzukommt, dass der Bauantrag vom 5. November 2024 nicht nur eine Anlage zur Flüchtlingsunterbringung im Sinn von § 246 Abs. 15 BauGB, sondern noch ein weiteres, nicht der Flüchtlingsunterbringung dienendes Teilvorhaben beinhaltete, auch wenn letzteres tatsächlich nicht einer Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen bedurfte. Vor diesem Hintergrund kann sich hier die Genehmigungsbehörde, der auch die Rechts- und Fachaufsicht über die Gemeinde obliegt, nicht darauf berufen, die Gemeinde hätte die fehlerhafte Rechtsauffassung der Genehmigungsbehörde erkennen und die Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen binnen Monatsfrist herbeiführen und übermitteln müssen.
Das gilt auch unter Berücksichtigung der Interessen der Bauherren, die in Bezug auf die Auslösung der Frist für eine etwaige fiktive Einvernehmenserteilung nach der Gesetzeslage stets davon abhängig sind, dass die Genehmigungsbehörde ein ordnungsgemäßes Ersuchen an die Gemeinde richtet. Nachdem es an einem ordnungsgemäßen Ersuchen fehlt, kommt es nicht darauf an, dass die gesetzlichen Einvernehmensfristen grundsätzlich nicht disponibel sind.“
2. Fehlende rechtliche Betroffenheit eines Nachbarn des Plangebietes bei ausschließlicher Berufung auf fehlende Erschließung
Die Normenkontrolle kann nur erheben, wer durch die Rechtsvorschrift oder ihre Anwendung eine Rechtsverletzung erlitten oder in absehbarer Zeit zu erwarten hat (§ 47 Abs. 2 VwGO). Diese Voraussetzung muss schlüssig dargelegt werden. Erforderlich, aber auch ausreichend ist es daher, dass der Antragsteller hinreichend substanziiert Tatsachen vorträgt, die es zumindest möglich erscheinen lassen, dass er durch die Norm in seinen Rechten verletzt wird. Nur dann, wenn eine Rechtsverletzung offensichtlich und eindeutig nach jeder Betrachtungsweise ausscheidet, kann die Antragsbefugnis verneint werden. Jedoch muss auch eine gewisse Beeinträchtigungsintensität vorliegen. Wann das der Fall ist, lässt sich nicht einheitlich, sondern nur in Ansehung der Gegebenheiten des konkreten Einzelfalles entscheiden. Auf eine Rechtsverletzung im Zusammenhang mit einer städtebaulichen Satzung kann sich der Antragsteller jedenfalls dann berufen, wenn er Eigentümer eines im Plangebiet liegenden Grundstücks ist und die planungsrechtliche Situation durch die Satzung zu seinem Nachteil verändert oder beeinträchtigt wird. In diesem Fall enthält der Bebauungsplan Inhalts- beziehungsweise Schrankenbestimmungen gemäß Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG, die auf einer rechtmäßigen Normberuhen müssen. Außerdem – und das hat Bedeutung vor allem für Grundstücke, die außerhalb des überplanten Bereichs liegen – hat das in § 1 Abs. 7 BauGB enthaltene Abwägungsgebot hinsichtlich solcher privaten Belange drittschützenden Charakter, die für den Abwägungsvorgang erheblich sind27. Nicht notwendig sind daher dem Abwägungsvorgang vorausliegende materielle subjektive Rechtspositionen. Geschützt ist dabei jedoch nicht der betreffende Belang als solcher, der Antragsteller hat vielmehr nur einen Anspruch auf angemessene Berücksichtigung seiner geschützten Interessen in der Abwägung. Antragsbefugt ist somit jeder, der sich auf einen abwägungserheblichen privaten Belang berufen kann.
In diesem Zusammenhang hatte der BayVGH den folgenden Fall zu entscheiden28: Der Antragsteller wendet sich gegen eine Innenbereichssatzung als Ergänzungssatzung einer früheren Einbeziehungssatzung, mit der zwei Grundstücke in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen werden. Das Grundstück des Antragstellers ist mit einem Wohnhaus bebaut. Die straßenmäßige Erschließung erfolgt über eine schmale asphaltierte Ortsstraße, die in West-Ost-Richtung an der nördlichen Grundstücksgrenze des Antragstellers entlang verläuft und kurz nach der nordöstlichen Grundstücksgrenze des Antragstellers in einen Fuß- beziehungsweise Feldweg übergeht. Teil der Ortsstraße ist eine Brücke, deren Tonnage auf 5 t beschränkt ist. Im Satzungsverfahren trug der Antragsteller vor, die (straßenmäßige) Erschließung der einbezogenen Grundstücke sei nicht gesichert. Die Zufahrt müsse über die fragliche Ortsstraße erfolgen, die nicht geeignet sei, zusätzlichen Verkehr und insbesondere Baustellenverkehr aufzunehmen, da sie im Bereich der einbezogenen Grundstücke in einen Feld- beziehungsweise Fußweg übergehe und die Tonnage auf 5 t beschränkt sei. Der Antragsteller trägt im Gerichtsverfahren vor, er sei antragsbefugt, da eine Verletzung des Abwägungsgebots aus § 1 Abs. 7 BauGB in Rede stehe. Zudem habe er im Rahmen der Auslegung und Beteiligung die entsprechenden Einwände geltend gemacht. Das ließ der Senat nicht gelten. In seinem Beschluss führt er auszugsweise Folgendes aus:
„Der Antragsteller beruft sich auf eine nicht ausreichende straßenmäßige Erschließung der neu hinzukommenden Grundstücke. Die Sicherung der Erschließung ist ein aus schließlich dem öffentlichen Interesse dienendes Genehmigungserfordernis (vgl. HKVerwR/Christoph Sennekamp, VwGO, 5. Aufl. 2021, § 42 Rn. 100). Es ist im Einbeziehungssatzungsverfahren auch nicht absehbar, dass der Nachweis einer ausreichenden wegemäßigen Erschließung im späteren Baugenehmigungsverfahren nicht erbracht werden kann. Zwar kann beziehungsweisemuss die Gemeinde im Satzungsverfahren Belange eines mittelbar Planbetroffenen unterhalb der Schwelle des Drittschutzes einbeziehen und abwägen, wenn sich dies im Einzelfall aufdrängt oder überhaupt erkennbar ist. So liegt der Fall hier jedoch offensichtlich nicht.
Die fragliche Ortsstraße ist derzeit geeignet, den für die straßenmäßige Anbindung notwendigen Verkehr zum Grundstück des Antragstellers aufzunehmen. Soweit er mit Schriftsatz vom 3. Februar 2025 behauptet, es bestehe noch eine anderweitige straßenmäßige Erschließung für sein Grundstück, kann dies nicht nachvollzogen werden, da er selbst vorträgt, dabei handele es sich um ein Wiesengrundstück. Es ist nichts dafür ersichtlich und auch nichts dafür vorgetragen, dass die Ortsstraße für den Fall eines entsprechenden Ausbaus im weiteren Straßenverlauf hin zu den Grundstücken Flurnummern 777 und 739 nicht in der Lage sein sollte, den neu hinzukommenden Verkehr für die geringfügig hinzutretende neue Wohnbebauung zu bewältigen. Etwaige auch nur ansatzweise das vernachlässigbare Maß überschreitende verkehrliche Immissionsbelastungen werden vom Antragsteller nicht vorgetragen und sind auch sonst nicht ersichtlich. Soweit der Antragsteller vage befürchtet, während der Bauphase könnte es zu Beschädigungen der fraglichen Ortsstraße aufgrund einer möglichen Überschreitung der Tonnagebeschränkung kommen, kann dem ohne weiteres durch entsprechende Auflagen im Baugenehmigungsverfahren begegnet werden. Anlass, sich hiermit bereits im Satzungsverfahren zu beschäftigen, bestand damit nicht, auch wenn die Antragsgegnerin dies möglicherweise überobligatorisch getan hat.“
1 Beutling, Öffentliches Baurecht, Schriftenreihe der Hagen Law School, Stand 2024, S. 42 f.
2 OVG Berlin-Bbg, U.v. 22.09.2011 – OVG 2 A 8/11.
3 B.v. 07.01.2025 – 2 N 20.1514.
4 Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 15. Aufl. 2022, § 11 Rn. 72 m. w. N.
5 Ernst/Zinkahn/Bielenberg, 155. EL August 2024, BauGB, § 1 Rn. 31 a.E.
6 Beutling, Öffentliches Baurecht, Schriftenreihe der Hagen Law School, Stand 2024, S. 78 f.
7 Beutling, Öffentliches Baurecht, Schriftenreihe der Hagen Law School, Stand 2024, S. 48 ff.
8 Vgl. Beutling, Öffentliches Baurecht, Schriftenreihe der Hagen Law School, Stand 2024, S. 21 und 107.
9 Lüttgau, jurisPR-UmwR 3/2024 Anm. 2.
10 B.v. 13.11.2023 – 2 NE 23.1841.
11 BVerwG, U.v. 07.09.2017 – 4 C 8.1.
12 BVerwG, U.v. 09.02.2017 – 4 C 4.16.
13 VGH BW, U.v. 17.05.2013 – 8 S 313.11.
14 Beutling, Öffentliches Baurecht, Schriftenreihe der Hagen Law School, Stand 2024, S. 114.
15 B.v. 01.10.2024 – 1 CS 24.1449.
16 Beutling, Öffentliches Baurecht, Schriftenreihe der Hagen Law School, Stand 2024, S. 274 f.
17 B.v. 08.01.2025 – 2 ZB 24.432.
18 B.v. 27.06.2024 – 2 BV 22.501.
19 Vgl. Beutling, Öffentliches Baurecht, Schriftenreihe der Hagen Law School, Stand 2024, S. 284.
20 Zum Rücksichtnahmegebot in seiner immissionsschutzrechtlichen Ausprägung vgl. Beutling, Öffentliches Baurecht, Schriftenreihe der Hagen Law School, Stand 2024, S. 277.
21 BayVGH, U.v. 04.09.2023 – 9 B 22.1196.
22 Michael, jurisPR-OffBauR 4/2024 Anm. 6.
23 B.v. 23.11.2023 – 9 CS 23.1538.
24 Vgl. grds. zum gemeindlichen Einvernehmen Beutling, Offentliches Baurecht, Schriftenreihe der Hagen Law School, Stand 2024, S. 110 ff.
25 Battis/Krautzberger/Löhr/Reidt, BauGB, 15. Aufl. 2022, § 36 Rn. 21.
26 B.v. 26.02.2025 – 2 CS 25.290.
27 Riese, Verwaltungsprozessrecht, Schriftenreihe der Hagen Law School, Stand 2024, S. 107.
28 B.v. 10.02.2025 – 2 N 22.984.
Beitrag entnommen aus Bayerische Verwaltungsblätter 12/2025, S. 397.