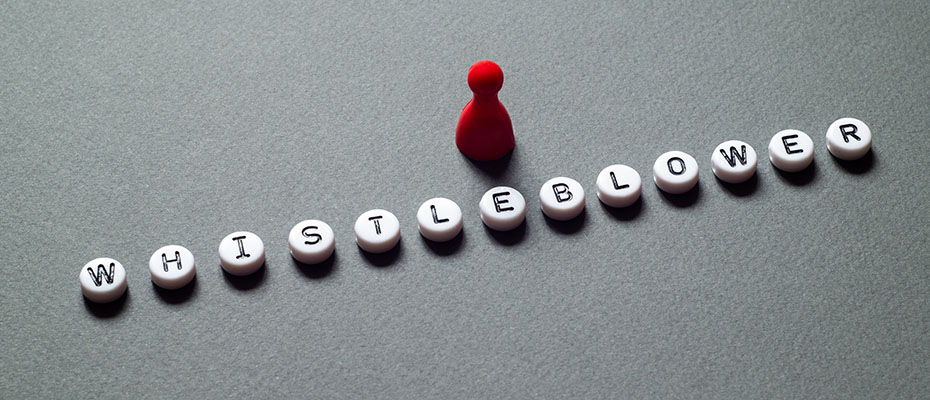Die Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (ABl. L 305 v. 26.11.2019), wurde durch den Bundesgesetzgeber mit dem Hinweisgeberschutzgesetz (im Folgenden: HinSchG) in nationales Recht umgesetzt.
Dieser Artikel befasst sich im Schwerpunkt mit der Umsetzung des HinSchG für die staatlichen Behörden im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration (StMI) sowie der Einrichtung und dem Betrieb interner Meldestellen.
1. Entstehungsgeschichte
Die so genannte Whistleblower-Richtlinie (EU) 2019/1937 war bis zum 17. Dezember 2021 in den Mitgliedstaaten umzusetzen und Anlass für die Regelungen im HinSchG. Die Entstehung des HinSchG war jedoch nicht geradlinig. Das Bundesministerium der Justiz (und für Verbraucherschutz) hatte bereits im Dezember 2020 einen Referentenentwurf zur Umsetzung der Richtlinie in die Ressortabstimmung gegeben, der aufgrund des Widerspruchs anderer Ressorts nicht veröffentlicht wurde1. Am 13. April 2022 veröffentlichte das Bundesministerium der Justiz einen weiteren Referentenentwurf für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen sowie zur Umsetzung der Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden. Ein darauf basierender Gesetzentwurf wurde am 16. Dezember 2022 vom Bundestag beschlossen. Der Gesetzentwurf betraf verschiedene Rechtsgebiete und fiel deshalb in den Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung nach Art. 74 GG sowie der ausschließlichen Gesetzgebung nach Art. 73 GG. Der Bundesrat stimmte dieser Fassung in seiner Sitzung am 10. Februar 2023 jedoch unter Verweis auf Art. 74 Absatz 2 i. V. m. Absatz 1 Nummer 27 und Art. 80 Absatz 2 des Grundgesetzes nicht zu. Die größten Unterschiede in den Auffassungen betrafen die Fragen des sachlichen Anwendungsbereichs des HinSchG und der Einrichtung von Meldekanälen, die eine anonymisierte Kommunikation mit dem Hinweisgeber erlauben. Die Bundesregierung rief daraufhin den Vermittlungsausschuss nach Art. 77 Abs. 2 GG an, der sich am 9. Mai 2023 auf einen Kompromiss einigen konnte2. Das Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen sowie zur Umsetzung der Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, wurde schließlich am 11. Mai 2023 vom Deutschen Bundestag beschlossen und im BGBl. 2023 I Nr. 140 vom 2. Juni 2023 veröffentlicht. Neben einem neuen Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen (HinSchG) enthält es Änderungen diverser bestehender Rechtsvorschriften.
Diese Entstehungsgeschichte muss bei der Auslegung von einzelnen Normen des Gesetzes im Auge behalten werden, insbesondere wenn die Begründung des Regierungsentwurfs für die Auslegung des Gesetzes herangezogen werden soll. Es ist stets zu prüfen, ob und in welchem Umfang diese Erwägungen die finale Fassung des Gesetzes wiedergeben.
Das HinSchG regelt vor allem zwei wesentliche Aspekte: Zum einen wird die EU-Richtlinie umgesetzt, wobei das deutsche nationale Recht in seiner Umsetzung weit über die Richtlinie hinausgeht3. Insbesondere in Bezug auf den sachlichen Anwendungsbereich nach § 2 HinSchG ist dies der Fall. Von dem HinSchG werden neben unionsrechtlichen Vorschriften auch nationale Rechtsverstöße in einem sehr weiten Umfang erfasst. Zum anderen soll durch das HinSchG der nach Einschätzung der Bundesregierung bislang lückenhafte und unzureichende Schutz hinweisgebender Personen ausgebaut werden4. Für Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber soll Klarheit bestehen, wann und durch welche Vorgaben sie bei der Meldung oder Offenlegung von Verstößen geschützt sind.
2. Umsetzung auf der Landesebene
Das HinSchG schützt Personen, die in gutem Glauben Informationen aus dem beruflichen Umfeld über rechtswidriges Verhalten oder Missstände melden, vor Repressalien und Benachteiligungen. Es verpflichtet Organisationen zur Einrichtung interner Meldestellen und regelt die Verfahren zur vertraulichen Bearbeitung dieser Meldungen. Zudem sieht das Gesetz rechtliche Schritte und Entschädigungsansprüche für benachteiligte Hinweisgeber vor.
Kernstück der Regelungen zum Hinweisgeberschutz ist die Pflicht zur Einrichtung und zum Betrieb interner Meldestellen. Nach § 12 Abs. 1 Satz 1 HinSchG haben Beschäftigungsgeber dafür zu sorgen, dass bei ihnen mindestens eine Stelle für interne Meldungen eingerichtet ist und betrieben wird, an die sich Beschäftigte wenden können (interne Meldestelle). § 12 HinSchG in Verbindung mit § 3 Abs. 9 HinSchG legt fest, wer als Beschäftigungsgeber gilt und deshalb zur Einrichtung einer internen Meldestelle verpflichtet ist. § 12 Abs. 1 Satz 2 HinSchG gibt einem Land als Beschäftigungsgeber eine besondere Gestaltungsmöglichkeit. Die obersten Landesbehörden können danach Organisationseinheiten in Form von einzelnen oder mehreren Behörden, Verwaltungsstellen, Betrieben oder Gerichten festlegen, mit der Folge, dass die Pflicht zur Einrichtung interner Meldestellen bei den jeweiligen Organisationseinheiten besteht. Die Gestaltungsmöglichkeit ermöglicht es den Ländern als Beschäftigungsgeber, flexibel auf die organisatorischen Bedürfnisse der öffentlichen Verwaltung einzugehen und zu kleinteilige Strukturen zu vermeiden, solange die Effektivität gewährleistet ist5. Diese bundesrechtliche Ermächtigung zur Bestimmung der internen Stelle stellt keine Ermächtigung zum Erlass einer Verordnung dar. Eine solche könnte gemäß Art. 80 Abs. 1 GG nur an die Landesregierung, nicht aber an oberste Landesbehörden adressiert werden. § 12 HinSchG geht vielmehr von einer bloßen Organisationsverfügung der obersten Landesbehörden als Grundlage für die Bestimmung der internen Meldestelle aus. Einer zusätzlichen gesetzlichen Regelung für die Bestimmung von Organisationseinheiten bedarf es nach den Regelungen des HinSchG nicht. Die Anforderungen des Art. 77 Abs. 1 Satz 1 BV an Zuständigkeitsregelungen finden bei der Inanspruchnahme der bundesrechtlichen Ermächtigung zur Bestimmung der internen Meldestelle keine Anwendung. Denn die wesentlichen Bestimmungen zu Aufgaben und Befugnissen einer internen Meldestelle sind bereits im HinSchG selbst geregelt. Der aus rechtsstaatlichen Gründen notwendigen Publizität hinsichtlich der Festlegung der internen Meldestelle wird dadurch Rechnung getragen, dass die Organisationsverfügung des Beschäftigungsgebers allen Beschäftigten bekannt zu machen ist. Die Einrichtung der internen Meldestelle kann demnach für den staatlichen Bereich im Rahmen einer allgemeinen Behördenorganisation nach Art. 77 Abs. 1 Satz 2 BV erfolgen.
a. Auf staatlicher Ebene
Die Bayerische Staatsregierung hat entschieden, dass die Umsetzung des HinSchG in Ressortverantwortung zu erfolgen hat. In der Konsequenz obliegt es jedem Ministerium als oberster Landesbehörde, Organisationseinheiten im Sinn von § 12 Abs. 1 Satz 2 HinSchG festzulegen, für die die Pflicht zur Einrichtung interner Meldestellen besteht. Durch diese gesetzlichen Vorgaben kann flexibel auf die organisatorischen Bedürfnisse der öffentlichen Verwaltung reagiert werden, die eine niedrigschwellige Erreichbarkeit einer internen Meldestelle gewährleistet, ohne ineffiziente und zu kleinteilige Strukturen schaffen zu müssen6. Im Ergebnis können passgenaue Lösungen, die die jeweiligen Besonderheiten im Ressort beachten, umgesetzt werden.
Nach § 20 HinSchG kann jedes Land eine eigene externe Meldestelle einrichten für Meldungen, die die jeweilige Landesverwaltung und die jeweiligen Kommunalverwaltungen betreffen. In Bayern ist von dieser gesetzlichen Möglichkeit kein Gebrauch gemacht worden. Für diesen Fall greift die Zuständigkeitsregel des § 19 HinSchG für die externe Meldestelle des Bundes für hinweisgebende Personen. § 19 Abs. 4 HinSchG regelt eine subsidiäre Zuständigkeit und bestimmt insoweit, dass die externe Meldestelle des Bundes nur dann zuständig ist, soweit nicht eine externe Meldestelle nach den §§ 20 bis 23 zuständig ist.
b. Umsetzung für den Geschäftsbereich des StMI
Das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration hat sich nach Abwägung aller Umstände für eine dezentrale Umsetzung entschieden. In Anwendung der Gestaltungsoption des § 12 Abs. 1 Satz 2 HinSchG stellt im Grundsatz jede staatliche Behörde im Geschäftsbereich des StMI eine Organisationseinheit dar mit der Folge, dass im StMI sowie in den nachgeordneten Behörden grundsätzlich jeweils eine interne Meldestelle eingerichtet worden ist. Dies gilt für die sieben Regierungen, die Landesämter, die Staatlichen Feuerwehrschulen, die Landesanwaltschaft und die Landratsämter. Hiervon abweichend wurde eine Organisationseinheit bestehend aus den Verwaltungsgerichten und dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gebildet, mit der Folge, dass nur eine interne Meldestelle für diese Organisationseinheit einzurichten war.
Bei der Bayerischen Polizei wurden bei den Polizeipräsidien, dem Bayerischen Landeskriminalamt und dem Polizeiverwaltungsamt interne Meldestellen eingerichtet.
Für diese Entscheidung waren verschiedene Gesichtspunkte ausschlaggebend. Die gewählte Umsetzung entspricht zuvorderst am unmittelbarsten der ursprünglichen Zielrichtung der Richtlinie: Empirische Untersuchungen belegen, dass Hinweisgeber mehrheitlich zu internen Meldungen innerhalb der Organisation, in der sie arbeiten, neigen7. Ein weiterer entscheidender Punkt war die Größe des Personalkörpers mit rund 57 000 Stellen, von denen allein 43 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Bayerische Polizei entfallen. Die Konzentration auf eine einzige interne Meldestelle hätte also zu einer erheblichen Belastung dieser einen Stelle geführt, auch abhängig von dem tatsächlich anfallen Meldevolumen, das bis heute nicht seriös einzuschätzen ist.
Zudem sprechen organisatorische Überlegungen gegen eine Konzentration auf eine Meldestelle im Geschäftsbereich des StMI. Da es sich bei den Aufgaben der internen Meldestelle um eine reine Vollzugsaufgabe handelt, stellt die Vorhaltung einer Meldestelle keine ministerielle (Kern-)Aufgabe dar, die im Ministerium selbst zu vollziehen wäre8.
3. Kommunale Regelung
Die Verpflichtung, interne Meldestellen einzurichten und zu betreiben, gilt für Gemeinden und Gemeindeverbände und solche Beschäftigungsgeber, die im Eigentum oder unter der Kontrolle von Gemeinden und Gemeindeverbänden stehen, nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts, vgl. § 12 Abs. 1 Satz 4 HinSchG. Diese Regelung beruht auf dem Durchgriffsverbot aus Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG. Es war Aufgabe des Landesgesetzgebers, für eine entsprechende Umsetzung zu sorgen. Der Bayerische Landtag hat deshalb am 19. Juli 2023 das Gesetz zur Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften verabschiedet, das zur Umsetzung der Vorgaben des HinSchG für den kommunalen Bereich Ergänzungen der Kommunalgesetze in der Gemeindeordnung (GO), der Landkreisordnung (LKrO) und der Bezirksordnung (BezO) vorsieht. Über Verweise auf die maßgeblichen Vorschriften des HinSchG sind auch die Kommunen als Beschäftigungsgeber zur Einrichtung und zum Betrieb interner Meldestellen verpflichtet. Davon ausdrücklich ausgenommen sind Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern oder in der Regel weniger als 50 Beschäftigten sowie sonstige kommunale Beschäftigungsgeber mit in der Regel weniger als 50 Beschäftigten. Die bayerische Lösung sieht in Art. 56 Abs. 4 Satz 3 GO die Möglichkeit vor, dass die Kommunen auch eine geeignete staatliche interne Meldestelle im Geschäftsbereich des StMI als „Dritten” im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 2 HinSchG mit den Aufgaben der internen Meldestelle betrauen können. Für die sonstigen kommunalen Beschäftigungsgeber gilt dies über einen Verweis auf Art. 56 Abs. 4 Satz 3 GO entsprechend, vgl. Art. 97 Satz 3 GO, Art. 50 Abs. 2 Satz 3 LKrO, Art. 85 Satz 3 LKrO, Art. 47 Abs. 2 Satz 3 BezO, Art. 81 Abs. 3 Satz 3 BezO. Als geeignete staatliche Meldestellen in diesem Sinne kommen dabei für die kreisangehörigen Gemeinden primär die Landratsämter und für die kreisfreien Städte die Regierungen in Betracht. Allerdings entbindet die Betrauung eines Dritten mit den Aufgaben einer internen Meldestelle den betrauenden Beschäftigungsgeber nicht von der Pflicht, selbstständig geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um etwaige Verstöße abzustellen, vgl. § 14 Abs. 1 Satz 2 HinSchG.
4. Aufgaben der internen Meldestelle
Die Aufgaben der internen Meldestelle werden in § 12 bis 18 HinSchG konkretisiert. Gemäß § 13 HinSchG betreiben die internen Meldestellen Meldekanäle nach § 16 HinSchG, führen das Verfahren nach § 17 HinSchG und ergreifen Folgemaßnahmen nach § 18 HinSchG.
a. Meldekanäle für interne Meldestellen
§ 16 HinSchG regelt zum einem, welchem Personenkreis die Meldekanäle für die interne Meldestelle offenstehen müssen, und macht zum anderen Vorgaben zur Einrichtung sowie Ausgestaltung interner Meldekanäle. Sie müssen zwingend den Beschäftigten und Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern der juristischen Person die Meldung von Informationen über Verstöße ermöglichen, § 16 Abs. 1 Satz 1 HinSchG. Hinsichtlich anderer Personengruppen ist es den Beschäftigungsgebern überlassen, ob und wie sie den Zugang zu internen Meldekanälen eröffnen (§ 16 Abs. 1 Satz 3 HinSchG).
Die Meldekanäle sind so zu gestalten, dass nur die für die Entgegennahme und Bearbeitung der Meldungen zuständigen sowie die sie bei der Erfüllung dieser Aufgaben unterstützenden Personen Zugriff auf die eingehenden Meldungen haben, § 16 Abs. 2 HinSchG. Durch Nutzung der Bayerischen Verwaltungs-PKI (Public Key Infrastructure) ist es möglich, E-Mails mithilfe von privaten und öffentlichen Schlüsseln (Zertifikaten) durch Verschlüsseln vor Mitlesern abzusichern und durch Signieren seine Identität als Absender und die Unverfälschtheit der E-Mail nachzuweisen und damit die Vorgaben des HinSchG zur Gestaltung der Meldekanäle zu erfüllen.
b. Verfahren bei internen Meldungen
§ 17 HinSchG regelt das förmliche Verfahren, wie die interne Meldestelle mit eingehenden Hinweisen von hinweisgebenden Personen umzugehen hat. Hierbei ergibt sich aus der Aufzählung in Absatz 1 eine zwingende Prozessabfolge. Danach bestätigt die interne Meldestelle der hinweisgebenden Person den Eingang der Meldung spätestens nach sieben Tagen (Nr. 1), prüft, ob der gemeldete Verstoß in den sachlichen Anwendungsbereich des § 2 HinSchG fällt (Nr. 2), hält mit der hinweisgebenden Person Kontakt (Nr. 3), prüft die Stichhaltigkeit der eingegangenen Meldung (Nr. 4), ersucht die hinweisgebende Person erforderlichenfalls um weitere Information (Nr. 5) und ergreift angemessene Folgemaßnahmen nach § 18 HinSchG (Nr. 6). Besonderes Interesse liegt auf der Aufgabe „Prüfung der Stichhaltigkeit” nach Nr. 4. Die interne Meldestelle hat zunächst eine Plausibilitätsprüfung vorzunehmen9. Hierbei soll geprüft werden, ob die in der Meldung genannten Informationen ausreichend begründete Verdachtsmomente oder Wissen über tatsächliche oder mögliche Verstöße beinhalten. Ob darüber hinaus umfangreiche interne Ermittlungen durch die interne Meldestelle durchzuführen sind, ist nicht geklärt. In größeren Unternehmen soll dies in der Regel durch eine eigens dafür eingerichtete Compliance-Einheit erfolgen10. In der öffentlichen Verwaltung dürften derartige Einheiten nicht eingerichtet sein und auch kein entsprechendes Personal vorgehalten werden. § 18 HinSchG regelt die Folgemaßnahmen, die die interne Meldestelle durchzuführen hat. Hierbei hat die Meldestelle immer die Vorgaben der Vertraulichkeit bzw. deren Ausnahmen zu beachten. So kann sie das Verfahren auch zwecks weiterer Untersuchungen an eine zuständige Behörde abgeben, vgl. § 18 Nr. 4b HinSchG. In der Praxis wird die interne Meldestelle in einer Landesbehörde wegen der allgemeinen Rechtsbindung entsprechend verfahren und das Verfahren im Regelfall an die örtlich zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben, wenn nach dem Ergebnis der Stichhaltigkeitsprüfung der internen Meldestelle ein Verstoß gegen eine Norm des materiellen Strafrechts möglich erscheint. Denn es sollen keine Doppelstrukturen zu den etablierten Strafverfolgungsbehörden geschaffen werden. Die Führung eines Ermittlungsverfahrens obliegt ausschließlich der zuständigen Staatsanwaltschaft. Nach Abgabe eines Verfahrens kann die interne Meldestelle aber eine wichtige Schnittstelle zwischen der Staatsanwaltschaft und der hinweisgebenden Person bilden, § 17 Abs. 2 HinSchG.
5. Schutzmaßnahmen
Im Abschnitt 4 des HinSchG sind die Schutzmaßnahmen für hinweisgebende Personen geregelt. Hierbei handelt es sich um ein zentrales Ziel des HinSchG, hinweisgebende Personen bei der Meldung oder Offenlegung von Missständen in der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung vor Repressalien zu schützen. Der bisher vorrangig durch Rechtsprechung geprägte Hinweisgeberschutz sollte durch den Erlass des Gesetzes zu mehr Rechtssicherheit für die Betroffenen führen. § 33 HinSchG verlangt grundsätzlich, dass eine hinweisgebende Person eine interne oder externe Meldung erstattet oder eine Offenlegung vorgenommen hat, die hinweisgebende Person hinreichenden Grund zu der Annahme hatte, dass die von ihr gemeldeten oder offengelegten Informationen der Wahrheit entsprechen und die Informationen Verstöße betreffen, die in den Anwendungsbereich des HinSchG fallen. Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen sind Repressalien gegen die hinweisgebende Person verboten, vgl. § 36 HinSchG. Durch diese Vorschrift wird der in der Whistleblower-Richtlinie geforderte Schutz von Whistleblowern in nationales Recht umgesetzt. In der Richtlinie ist nämlich zutreffend dargelegt, dass ein wirksamer Schutz des Hinweisgebers vor Repressalien wichtig für ein effektives Hinweisgebersystem ist11. Auch § 36 Abs. 2 Satz 1 HinSchG dient dem Schutz hinweisgebender Personen. Danach wird vermutet, dass eine Benachteiligung, die eine hinweisgebende Person im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit erleidet, und geltend macht, diese Benachteiligung infolge einer Meldung oder Offenlegung erlitten zu haben, eine Repressalie für die Meldung ist. Nach § 37 Abs. 1 HinSchG ist der Verursacher bei einem Verstoß gegen das Verbot von Repressalien verpflichtet, der hinweisgebenden Person den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
6. Fazit
Der Arbeit der internen Meldestellen kommt eine große Bedeutung zu, das Ziel des HinSchG zu erreichen, die Integrität und Gesetzestreue in Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung zu stärken. Es bleibt abzuwarten, ob sich eine „Meldekultur” entwickelt, die der Stärkung von Gesetzestreue dienlich ist. Zwar steht eine Evaluation der Inanspruchnahme der internen Meldestelle im Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration aus, aber eine Inanspruchnahme, die über Einzelfälle hinausgeht, ist nicht bekannt.
1 BMJ – Alle Meldungen – Besserer Schutz für Hinweisgeber.
2 Beschlussempfehlung BT-Drs. 20/6700 vom 09.05.2023.
3 So auch Bruns, NJW 2023, 1609/1610, Das neue Hinweisgeberschutzgesetz.
4 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 27.07.2022.
5 Fischbach in Thüsing, HinSchG § 12 Rn. 7.
6 BT-Drs. 20/3442 S. 77.
7 RL (EU) 2019/1937, vgl. dort Erw. 33.
8 Vgl. Grundsätze der Verwaltungsorganisation der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder.
9 Krebs in Schatz, HinSchG, Ubbo Aßmuss, § 17 Rn. 6.
10 Fischbach in Thüsing, HinSchG, § 18 Rn. 2.
11 Vgl. Erwägungsgrund 88 der Whistleblower-Richtlinie.
Beitrag entnommen aus Bayerische Verwaltungsblätter 13/2025, S. 443.