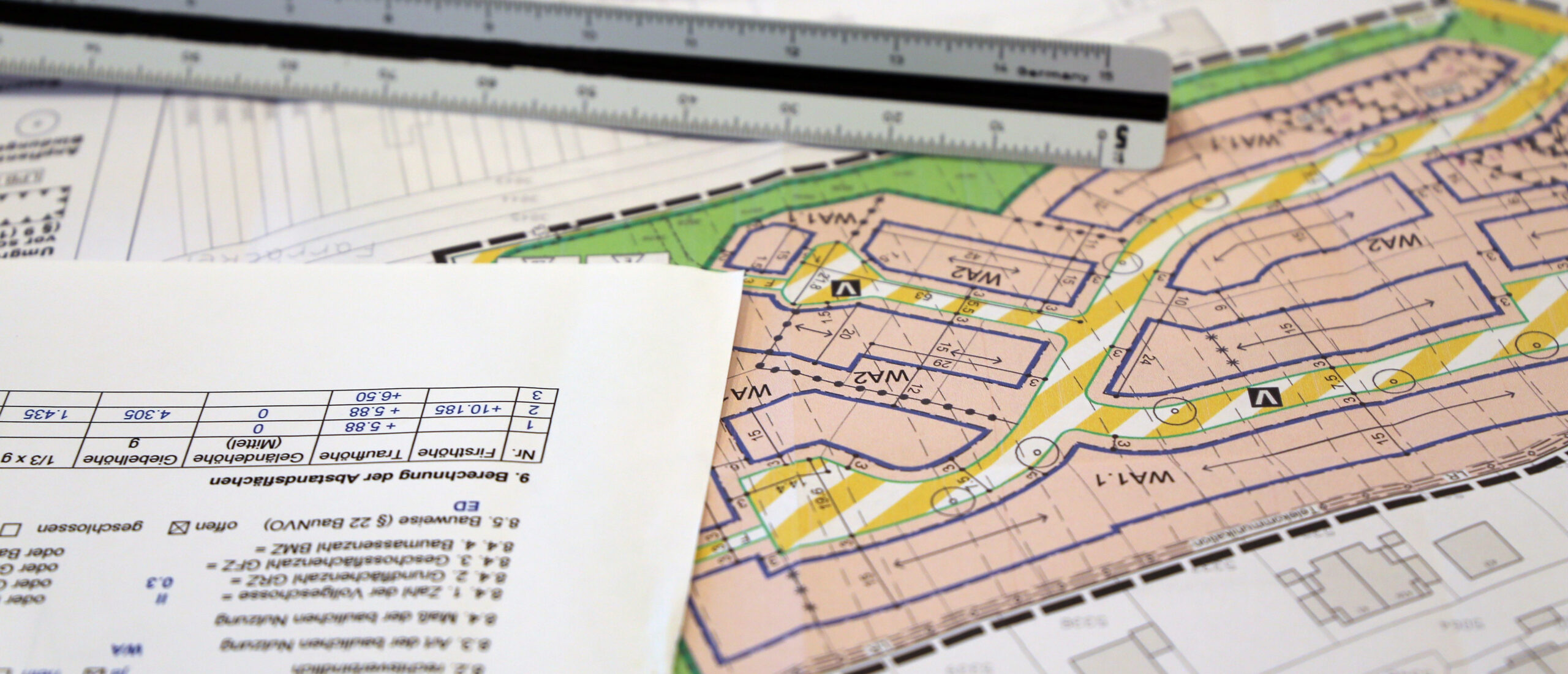Der Freistaat Bayern hat in der Ministerratssitzung vom 3. Dezember 2024 beschlossen, dass auf allen öffentlichen Verkehrsflächen in Bayern Elektroautos ab dem 1. April 2025 für drei Stunden kostenlos parken dürfen. Diese Neuregelung, die auf dem Verordnungsweg erfolgte, verpflichtet in erster Linie die Kommunen. Hierzu sind neben der Ermächtigungs- und Rechtsgrundlage auch die Vereinbarkeit mit Verfassungsrecht und der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie erforderlich und zu prüfen, ob möglicherweise das Konnexitätsprinzip zum Tragen kommt.
I. Neuregelung
Die Bayerische Staatsregierung hat in der Sitzung des Ministerrats vom 3. Dezember 2024 beschlossen, dass elektrisch betriebene Fahrzeuge (reine Batterieelektrofahrzeuge), von außen ladbare Hybridelektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge in Bayern auf öffentlichen Verkehrsflächen für die Dauer von drei Stunden kostenfrei parken können. Dies setze neue Impulse zur Beschaffung von Elektroautos, sodass eine Lenkungswirkung zugunsten klima- und umweltfreundlicher Fahrzeuge entstünde. Weiterhin solle dies insbesondere in Gebieten mit hohem Parkdruck Anreize schaffen, Elektroautos zu nutzen1. Die folgenden Ausführungen sollen diese politische Entscheidung rechtlich kontextualisieren:
1. Bundesrechtlicher Rechtsrahmen
Nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 22 des Grundgesetzes (GG) erstreckt sich die konkurrierende Gesetzgebung auch auf das Sachgebiet Straßenverkehr sowie die Erhebung und Verteilung von Gebühren oder Entgelten für die Benutzung öffentlicher Straßen mit Fahrzeugen. Weiterhin unterfällt diese Regelungsmaterie den Einschränkungen des Art. 72 Abs. 2 GG, sodass der Bund nur tätig werden kann, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich machen.
Vorliegend hat der Bund im Straßenverkehrsgesetz (StVG) auch Regelungen getroffen, die neben den Voraussetzungen auch Gebühren für das Parken auf öffentlichen Wegen und Plätzen vorsehen. Maßgebliche Rechtsnorm des Bundes für die geplante Neuregelung ist § 6a StVG, der die bundesrechtliche Rechtsgrundlage für eine Gebührenerhebung auf der Grundlage des Straßenverkehrsgesetz (StVG) einschließlich der darauf basierenden Rechtsverordnungen zugunsten der Länder darstellt2.
a) Gebührenerhebung auf Grundlage von § 6a Abs. 6 StVG
§ 6a Abs. 6 Satz 1 StVG normiert, dass die Gemeinden, im Übrigen die Träger der Straßenbaulast, für das Parken auf öffentlichen Wegen und Plätzen in Ortsdurchfahrten, Gebühren erheben können. § 6a Abs. 6 Satz 2 bis 4 StVG ermächtigt die Landesregierungen, für die Festsetzung der Gebühren Gebührenordnungen zu erlassen (Satz 2), in denen auch ein Höchstsatz festgelegt werden kann (Satz 3), wobei die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auch weiter übertragen werden kann (Satz 4).
Ergänzt wird die Regelung durch § 6a Abs. 7 StVG, der die Ermächtigungsnorm des § 6a Abs. 6 Satz 2 bis 4 StVG auf die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von bei Großveranstaltungen im Interesse der Ordnung und Sicherheit des Verkehrs eingerichteter gebührenpflichtiger Parkplätze entsprechend anzuwenden ist.
Diese Regelung, die im Jahr 2004 eingeführt wurde3, bezweckte, „die Parkgebührenerhebung künftig vollständig der freien Disposition der Kommunen zu überlassen. Eine staatliche Reglementierung dieses Bereiches erscheint nicht erforderlich, da die Kommunen ohnehin in eigener Verantwortung den straßenrechtlichen Widmungszweck, den garantierten Gemeingebrauch und den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten haben”4. In der Gesetzesbegründung wurde weiter ausgeführt, dass – anders als nach bisheriger Rechtslage – die Gemeinden beziehungsweise Träger der Straßenbaulast direkt zur Gebührenerhebung ermächtigt werden sollen.
Die Formulierung des § 6a Abs. 6 Satz 1 StVG stellt dabei klar,
„dass den Gemeinden beziehungsweise den Straßenbaulastträgern die Entscheidungsbefugnis zusteht, ob gebührenpflichtiges, gebührenfreies oder gebührenfreies Parken mit einer Beschränkung der Höchstparkdauer eingeführt wird. Die Festsetzung und Erhebung von Parkgebühren soll künftig völlig eigenverantwortlich nach den örtlichen Verhältnissen je nach Parkdruck erfolgen, wobei auch eine räumliche und zeitliche Staffelung vorgesehen oder von einer Gebührenerhebung zum Beispiel in der ersten halben Stunde abgesehen werden kann.
Die Einräumung von Parkmöglichkeiten stellt insbesondere in den Kernbereichen der Städte eine besondere Leistung dar, die über die üblichen Leistungen des Gemeinwesens für seine Benutzer hinausgeht. Es ist daher grundsätzlich sachgerecht, dass diejenigen Verkehrsteilnehmer, die diese besondere Leistung in Anspruch nehmen, auch angemessen zu den Kosten herangezogen werden, die der Aufrechterhaltung des Fahrzeugverkehrs durch bauliche und verkehrstechnische Maßnahmen dienen”5.
b) Bevorrechtigungen basierend auf § 3 Abs. 4 Nr. 4 EmoG
Eine § 6a Abs. 6 StVG ergänzende Rechtsgrundlage für Rechtsverordnungen, wie die der bayerischen Neuregelung, findet sich im Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge (Elektromobilitätsgesetz – EmoG). § 3 Abs. 4 EmoG lässt für elektrisch betriebene Fahrzeuge zu, dass diese Bevorrechtigungen für das Parken auf öffentlichen Straßen oder Wegen (Nr. 1), bei der Nutzung von für besondere Zwecke bestimmten öffentlichen Straßen oder Wegen oder Teilen von diesen (Nr. 2), durch das Zulassen von Ausnahmen von Zufahrtbeschränkungen oder Durchfahrtverboten (Nr. 3) sowie im Hinblick auf das Erheben von Gebühren für das Parken auf öffentlichen Straßen oder Wegen (Nr. 4) erhalten. Für Letzteres können dabei nach § 3 Abs. 6 EmoG in Rechtsverordnungen auch in Verbindung mit § 6a Abs. 6 Satz 2 und Satz 4 StVG Ermäßigungen der Gebühren oder Befreiungen von der Gebührenpflicht vorgesehen werden. Die hierdurch entstehenden Gebührenausfälle wurden weder beim Erfüllungsaufwand noch bei den Kosten der Gesetzesbegründung berücksichtigt6.
§ 3Abs. 6 EmoG stellt mithin eine Sonderregelung für spezielle Verkehrsteilnehmer dar und ermöglicht deren Ungleichbehandlung in Form einer Besserstellung. Nach der Gesetzesbegründung sollen insbesondere die für den Erlass von Gebührenordnungen zuständigen Länder Vergünstigungen oder Befreiungen für elektrisch betriebene Fahrzeuge vorsehen können7, wobei dies auch in Verbindungen mit Rechtsverordnungen, die auf § 6a Abs. 6 Satz 2 StVG beziehungsweise § 6a Abs. 6 Satz 4 StVG gestützt sind, erfolgen kann. Dabei dient die grundsätzliche Besserstellung durch das EmoG folgender Zielsetzung:
„Die Privilegierung von elektrisch betriebenen Fahrzeugen dient dem Klimaschutz, der Luftreinhaltung und der Minderung der Lärmemissionen sowie der Verminderung der Abhängigkeit von fossilen Treibstoffen”8.
2. Landesrechtliche Regelung
Der Freistaat Bayern hat von der Ermächtigungsnorm des § 6a Abs. 6 Satz 2 und 3 StVG Gebrauch gemacht. § 10 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) ist dabei mit dem Titel „Parkgebühren” die entscheidende landesrechtliche Regelung9.
a) Rechtslage vor dem 1. April 2025
Nach der bisherigen Rechtslage enthält § 10 ZustV für Parkgebühren im Freistaat Bayern folgende Regelung:
„1Die örtlichen und die unteren Straßenverkehrsbehörden können in ihrem Zuständigkeitsbereich unter Beachtung nachfolgender Höchstsätze Gebührenordnungen für das Parken nach § 6a Abs. 6 und 7 StVG erlassen. 2Die Parkgebühren dürfen höchstens 0,50 €, in Gebieten mit besonderem Parkdruck höchstens 1,30 € je angefangener halber Stunde betragen.”
Der Freistaat Bayern hat damit gemäß § 6a Abs. 6 Satz 4 in Verbindung mit § 6a Abs. 6 Satz 3 StVG die Ermächtigung, Gebührenordnungen für das Parken auf öffentlichen Wegen und Plätzen zu erlassen, auf die örtlichen und unteren Straßenverkehrsbehörden übertragen. Dabei ließ die Regelung des § 10 Satz 2 ZustV auch eine Staffelung der Gebührenhöhe zu, von der einige Kommunen Gebrauch gemacht haben.
b) Rechtslage ab 1. April 2025
Mittels Neuregelung, die das kostenlose Parken von Elektroautos auf öffentlichen Verkehrsflächen vorsieht, wird der bestehende § 10 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) vom 16. Juni 2015 um die folgenden Sätze 3 und 4 ergänzt:
„3Elektrisch betriebene Fahrzeuge im Sinne von § 2 Nr. 1 des Elektromobilitätsgesetzes (EmoG), die nach § 4 EmoG gekennzeichnet sind, sind in den ersten drei Stunden eines Parkvorgangs bei Nutzung der Parkscheibe oder Nutzung der jeweils angeordneten Einrichtung zur Überwachung der Parkzeit von der Entrichtung von Parkgebühren befreit. 4§ 3 Abs. 2 und 3 EmoG bleibt unberührt.”
Diese Neuregelung bezweckt, dass Elektroautos eine Befreiung von der Gebührenpflicht für die Parkdauer von drei Stunden enthalten. Dabei wird aufgrund der Verordnungsermächtigung des § 6a Abs. 6 StVG lediglich das Parken „auf öffentlichen Wegen und Plätzen” erfasst. Keine Anwendung findet diese Regelung auf kommunale oder private Parkhäuser oder Parkgaragen, da diese grundsätzlich keine öffentlichen Wege oder Plätze darstellen.
Die Vorgabe des § 10 Satz 3 und 4 ZustV müssen die Kommunen bei der Gestaltung ihrer Gebührensatzung berücksichtigen und diese im erforderlichen Fall anpassen. Parken Elektroautos länger als drei Stunden, so kommt die von den Kommunen erlassene Gebührenordnung wieder zur Anwendung.
Dabei bedarf es auch keiner Umsetzung der vorgesehenen Rechtslage in einem Gesetz in formellem Sinne. Die ZustV beruht auf der Verordnungsermächtigung durch den Bundesgesetzgeber in § 6a Abs. 6 Satz 2 bis 4 StVG, der selbst die wesentlichen Rahmenbedingungen für die Höchstsatzfestlegung von Parkgebühren vorgibt – denn letztlich handelt es sich bei der neuen Bestimmung um nichts anderes. Insoweit beansprucht die Regelung der ZustV unabhängig vom jeweiligen Ortsrecht und der Satzungshoheit der Kommunen – sofern diese überhaupt eine entsprechende Gebührensatzung für das Parken erlassen haben – unmittelbare Geltung.
Der Verweis auf § 2 Nr. 1 EmoG dient dabei zur Festlegung, dass neben reinen Elektroautos auch von außen aufladbare Hybridelektrofahrzeuge oder Brennstoffzellenfahrzeuge von der Befreiung erfasst werden. § 3 Abs. 2 EmoG enthält dabei für Hybridelektrofahrzeuge weitere Ausführungen, sodass nur PKW erfasst werden, die entweder eine Kohlendioxidemission von höchstens 50 Gramm je gefahrenem Kilometer haben oder deren Reichweite unter ausschließlicher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine mindestens 40 Kilometer beträgt.
II. Vereinbarkeit der Neuregelung mit Verfassungsrecht
1. Anwendung von Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG
Art. 80 Abs. 1 Satz 1 GG lässt die Möglichkeit zu, dass durch Gesetz die Bundesregierung, ein Bundesminister oder die Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Rechtsverordnungen von Landesorganen, die auf einer solchen bundesgesetzlichen Ermächtigung gemäß Art. 80 Abs. 1 Satz 1 GG beruhen, sind nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs Landesrecht10. Für Rechtsverordnungen der Staatsregierung auf der Grundlage eines Bundesgesetzes gilt Art. 80 Abs. 1 GG unmittelbar11.
Damit ist für die geplante Neuregelung auch Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG zu beachten, der normiert, dass Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung im Gesetz bestimmt werden müssten. Ob eine Ermächtigung zum Erlass von Verordnungen nach Inhalt, Zweck und Ausmaß hinreichend begrenzt ist, lässt sich nach der grundlegenden Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nur von Fall zu Fall entscheiden, wobei entscheidend ist, dass vorausgesehen werden kann, in welchen Fällen und mit welcher Tendenz von der Verordnungsermächtigung Gebrauch gemacht werden wird und welchen Inhalt die auf Grund der Ermächtigung erlassenen Verordnungen haben können12.
Dies ist letztlich vorliegend zu bejahen, da das EmoG – in Abwandlung und Ergänzung des StVG – die Länder neben den Kommunen ermächtigt, entsprechende Rechtsverordnungen zu erlassen, deren Ziel die Befreiung von Elektroautos von der Gebührenpflicht ist. Auch gibt es die Möglichkeit der Bevorzugung der erfassten Fahrzeuge als Gestaltungsziel direkt vor.
1 Vgl. Bayerischer Staatskanzlei, PM Nr. 391 v. 03.12.2024, 3.
2 Vgl. Hühnermann in Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke, Straßenverkehrsrecht, 28. Aufl. 2024, § 6a Rn. 1.
3 Vgl. Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes v. 14.01.2004, BGBl. 2004 I 74.
4 BT-Drs. 15/1496 v. 28.08.2003 S. 6.
5 BT-Drs. 15/1496 v. 28.08.2003 S. 6.
6 BR-Drs. 436/14 S. 2 f.
7 Vgl. BT-Drs. 18/3418 v. 03.12.2024 S. 28.
8 BR-Drs. 436/14 S. 8, 10.
9 Vgl. Zuständigkeitsverordnung (ZustV) v. 16.06.2015, BayGVBl. 2015, 184, zuletzt durch Verordnung v. 16.09.2024, GVBl. 2024, 458, geändert.
10 Vgl. BVerfG, B.v. 23.03.1965 – 2 BvN 1/62 – BayVBl. 1965, 235; Bay- VerfGH, E.v. 28.07.1988 – Vf. 8 – VII – 84, BayVBl. 1988, 717.
11 Vgl. Lindner in Lindner/Möstl/Wolff, Verfassung des Freistaates Bayern, 2. Aufl. 2017, Art. 55 Rn. 36 Fn. 58.
12 Vgl. BVerfG, U.v. 23.10.1951 – 2 BvG 1/51 – BVerfGE 1, 14/60.
Den vollständigen Beitrag lesen Sie in Bayerische Verwaltungsblätter 14/2025, S. 477.