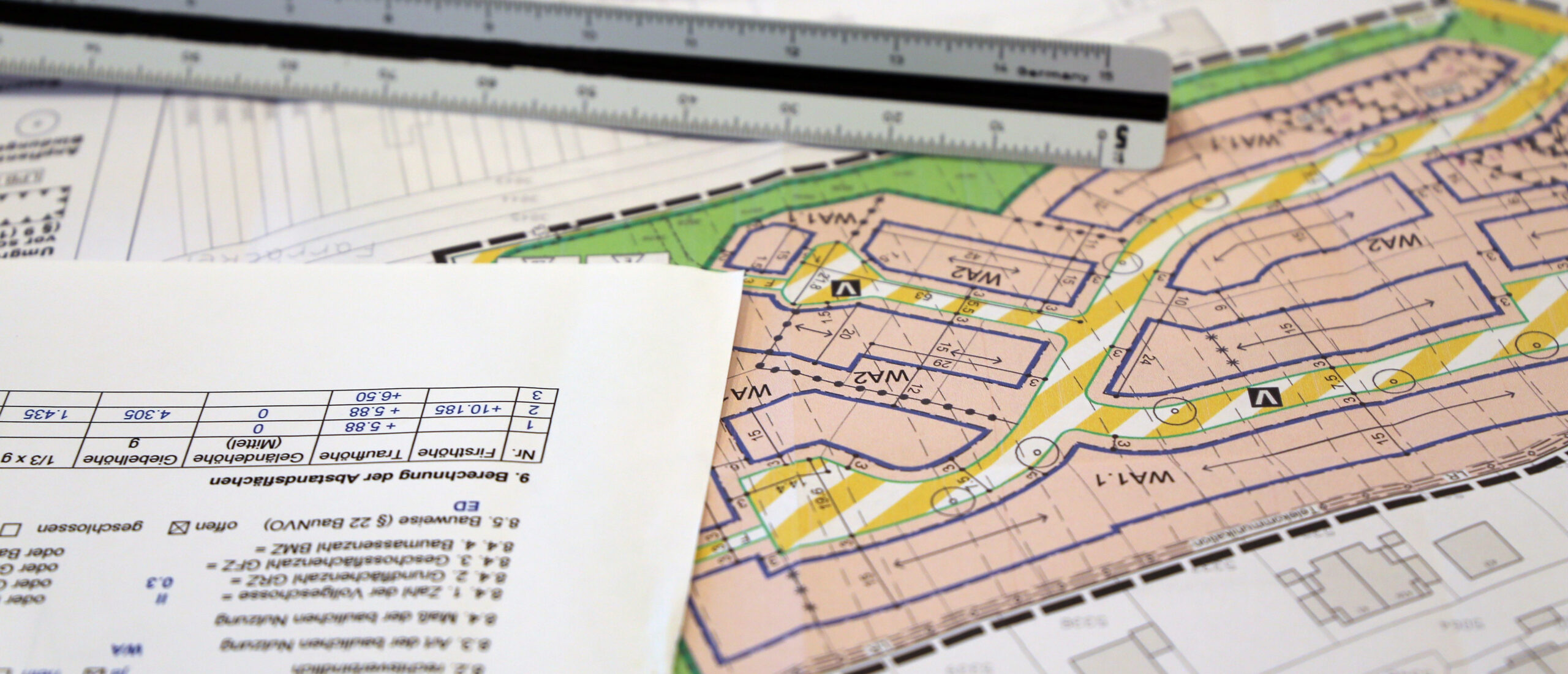Dem unten vermerkten Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH) vom 7.1.2025 lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Antragsteller in einem Normenkontrollverfahren wendet sich gegen einen Bebauungsplan der Antragsgegnerin. Festgesetzt werden ein allgemeines Wohngebiet mit über 50 Bauparzellen für Einzel- und Doppelhäuser sowie eine Umgehungsstraße. Das überplante Gebiet liegt weitgehend im bisherigen Außenbereich.
Die Aufstellung des Bebauungsplans dient der Ausweisung von Wohnbauflächen zur Deckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung sowie der Entlastung des Ortskerns von B. durch die Umgehungsstraße. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung seien in der Stadtverwaltung zahlreiche Anfragen zu Wohnbaugrundstücken registriert gewesen. Zur möglichen Innenentwicklung heißt es, die Gebäudeleerstände sowie die Baulücken seien alle in Privatbesitz und könnten auf Nachfrage der Stadt bei den Eigentümern auch kurz- bis mittelfristig nicht erworben werden. Die vorliegende Planung werde somit aufgestellt, da in der Stadt Potenziale der Innenentwicklung nicht in ausreichender Menge gegeben seien.
Bereits vor der Beschlussfassung über den Bebauungsplan schloss die Antragsgegnerin, die Eigentümerin einiger weniger Flächen im Plangebiet ist, mit den beiden Eigentümern der restlichen als Bauland ausgewiesenen, deutlich überwiegenden Flächen im Plangebiet einen städtebaulichen Vertrag, in dem auf den streitgegenständlichen Bebauungsplan und dessen Planungsziele Bezug genommen wird. Damit Wohnbauland tatsächlich dem Wohnbedarf der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werde, bedürfe es eines städtebaulichen Vertrags. In diesem wird im Einzelnen geregelt, dass und wie die ortsansässige Bevölkerung für einen bestimmten Zeitraum bei der Vergabe von Wohngrundstücken zu bevorzugen ist. Eine Bevorzugung von sozial schwachen Personen wird nicht geregelt.
Der Antragsteller, ein Landwirt, ist Eigentümer von im Plangebiet gelegenen Grundstücken. Teilflächen der Grundstücke werden mit einer öffentlichen Verkehrsfläche überplant. Insoweit befürchtet der Antragsteller die Durchführung eines Enteignungsverfahrens. Darüber hinaus meint er, durch die Festsetzung des Bebauungsplans daran gehindert zu sein, seine Flächen für einen geplanten Aussiedlerhof nutzen zu können. Der Bebauungsplan wurde aufgehoben. In seinem Beschluss führt das Gericht auszugsweise Folgendes aus:
Keine gemeindliche Planungsbefugnis, wenn die Bauleitplanung nicht geeignet ist, das gemeindliche Planungsziel zu erreichen
„Bauleitpläne sind erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB, soweit sie nach der planerischen Konzeption der Gemeinde erforderlich sind. In ständiger Rechtsprechung weist das Bundesverwaltungsgericht darauf hin, dass es Sache der Gemeinde sei, wie sie ihre Planungshoheit handhabe und welche Konzeption sie ihr zu Grunde lege, dass die Entscheidung über planerische Zielsetzungen eine Frage der Gemeindepolitik und nicht bloße Rechtsanwendung sei und dass sich die geordnete städtebauliche Entwicklung im Einzelfall nach den vorhandenen, hinreichend konkretisierten planerischen Willensbetätigungen der Gemeinde bestimme (vgl. zuerst BVerwG, U. v. 29.4.1964 – 1 C 30.62 – juris Rn. 20). Der Gesetzgeber ermächtigt die Gemeinde, diejenige Städtebaupolitik zu betreiben, die ihren städtebaulichen Ordnungsvorstellungen entspricht…Hieraus ergibt sich ohne weiteres, dass es an der gemeindlichen Planungsbefugnis fehlt, wenn die fragliche Bauleitplanung im Einzelfall offensichtlich nicht geeignet ist, das gemeindliche Planungsziel sicherzustellen.“
Die Sicherstellung der Erreichung der Planungsziele eines Bebauungsplans kann sich aus einem wirksamen städtebaulichen Vertrag ergeben, der diesen ergänzen soll
„Weder aus dem Bebauungsplan selbst noch aus seiner Begründung ergibt sich, wie sichergestellt sein soll, dass die beiden genannten Planungsziele mittels der streitgegenständlichen Bauleitplanung auch verwirklicht werden können. Die nunmehr überplanten Flächen befinden sich größtenteils in Privatbesitz. Weder die Verkaufsbereitschaft überhaupt noch die Sicherstellung, dass ortsansässige Bewerber bevorzugt behandelt werden, sind damit, wenn man allein den streitgegenständlichen Bebauungsplan betrachtet, gewährleistet. Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuchs vorzubereiten und zu leiten (§ 1 Abs. 1 BauGB). Der Grundsatz der Planmäßigkeit ,nach Maßgabe dieses Gesetzes‘ lässt es nicht zu, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke durch andere Mittel als die der Bauleitplanung förmlich vorzubereiten und zu leiten … Ergänzende vertragliche Gestaltungen im Zusammenhang mit der Bauleitplanung in Form eines städtebaulichen Vertrages können aber zulässig sein, solange sie weder an die Stelle der Entwicklungs- und Ordnungsfunktion der Bauleitplanung treten, noch die Bauleitplanung zu einer lediglich formalen Hülse werden lassen…
Der städtebauliche Vertrag vom 20.3.2020 wäre grundsätzlich geeignet, die Erreichung der genannten Planungsziele sicherzustellen, da er sowohl die Veräußerungsbereitschaft der privaten Grundstückseigentümer überhaupt als auch die Bevorzugung der ortsansässigen Bevölkerung festzuschreiben versucht. Ob damit der grundsätzliche Vorrang der Bauleitplanung zu stark ausgehöhlt wird und ob die sonstigen Voraussetzungen für eine Zusammenschau von Bauleitplanung und städtebaulichem Vertrag vorliegen (vgl. hierzu OVG BB, U. v. 22.9.2011 – OVG 2 A 8/11 – BeckRS 2012, 45009) kann dahinstehen, da der Vertrag jedenfalls, soweit er die Bevorzugung der ortsansässigen Bevölkerung sicherstellen soll, unwirksam ist.
Er gibt den derzeitigen Grundstückseigentümern vor, die Baugrundstücke zwei Jahre nach Fertigstellung der letzten Erschließungsanlage ausschließlich an Einheimische zu vergeben. Dies kann zwar grundsätzlich Inhalt eines städtebaulichen Vertrages sein, setzt aber voraus, dass es sich bei der insoweit bevorzugten örtlichen Bevölkerung um einkommensschwächere und weniger begüterte Personen handelt (§ 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 letzte Alt. BauGB). Es existieren im Vertragswerk keinerlei Regelungen, um letztere Voraussetzung sicherzustellen.“
Ein städtebaulicher Vertrag, der die Bevorzugung der ortsansässigen Bevölkerung bei der Vergabe von Wohngrundstücken regelt, ohne eine soziale Komponente zu erhalten, ist europarechtswidrig
„Zwar regelt § 11 BauGB den Inhalt von städtebaulichen Verträgen nicht abschließend. Ausweislich der Begründung des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt (vgl. BR-Drs. 18/11439 S. 20), mit dem § 11 BauGB seine aktuelle Fassung, die bei Inkrafttreten des streitgegenständlichen Bebauungsplans bereits galt, erhalten hat, sollte zur Vermeidung einer europarechtswidrigen Diskriminierung auch im Wortlaut der Vorschrift hervorgehoben werden, dass Einheimischenmodelle bei europarechtskonformer Ausgestaltung dem Erwerb angemessenen Wohnraums durch einkommensschwächere und weniger begüterte Personen der örtlichen Bevölkerung dienen. Hieraus ergibt sich ohne weiteres der Wille des Gesetzgebers, dass die Regelungen betreffend die Bevorzugung der örtlichen Bevölkerung im Rahmen von städtebaulichen Verträgen stets auch der Berücksichtigung der genannten sozialen Komponente bedürfen, nachdem andernfalls europarechtliche Vorschriften entgegenstehen könnten.
Auch mag es sich bei dem hier in Rede stehenden städtebaulichen Vertrag um einen solchen des Zivilrechts handeln. Jedoch muss er sich, nachdem eine Kommune Vertragspartner ist und er der Erfüllung von bauleitplanerischen Zielsetzungen dient, am Vorrang des Gesetzes messen lassen, sodass er aufgrund des Verstoßes gegen § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 letzte Alt. BauGB in entsprechender Anwendung von Art. 59 Abs. 1 BayVwVfG jedenfalls in der Frage der Bevorzugung von Einheimischen nichtig ist…
Da somit weder durch den Bebauungsplan selbst noch durch den städtebaulichen Vertrag die Erreichung der genannten Planungsziele sichergestellt ist, fehlt es der Planung an der notwendigen Erforderlichkeit im Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB. Folge einer fehlenden Erforderlichkeit und damit Planungsbefugnis im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 ist auch unter Berücksichtigung der Vorschriften der §§ 214 f. BauGB die Unwirksamkeit des Bauleitplans …“
[…]Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 7.1.2025 – 2 N 20.1514
Den vollständigen Beitrag lesen Sie in Die Fundstelle Bayern 16/2025, Rn. 171.