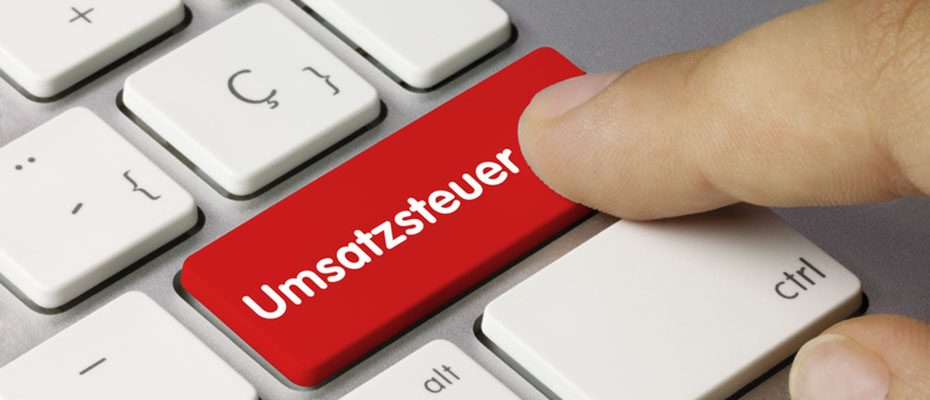Amtlicher Leitsatz:
Die eingeschränkte landwirtschaftliche Nutzbarkeit eines Grundstücks infolge eines auf diesem befindlichen Biotops spricht dafür, den Streitwert nicht nach § 52 Abs. 1 GKG unter Rückgriff auf Schätzungsrichtlinien betreffend den Ertrag landwirtschaftlich nutzbarer Flächen zu bestimmen, sondern mangels genügender Anhaltspunkte für eine ziffernmäßige Schätzung des Werts der noch möglichen landwirtschaftlichen Nutzung nach dem Auffangstreitwert des § 52 Abs. 2 GKG.
BayVGH, Beschluss vom 15.11.2023, 14 C 22.1012
Aus den Gründen:
1. Die Streitwertbeschwerde, der das Verwaltungsgericht nicht abgeholfen und über die der Senat als Spruchkörper zu entscheiden hat, weil der angegriffene verwaltungsgerichtliche Beschluss von der Kammer als Spruchkörper, nicht aber vom Einzelrichter oder Berichterstatter erlassen wurde (§ 68 Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 66 Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 2 GKG), ist zulässig, insbesondere konnte sie – entgegen der Auffassung der Beklagten – durch den nicht anwaltlich vertretenen Kläger selbst erhoben werden (§ 68 Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 66 Abs. 5 Satz 1 GKG).
2. Die Streitwertbeschwerde, die auf eine Festsetzung des Streitwerts in Höhe von 342 Euro abzielt, weil sich aus den mit ihr auszugsweise vorgelegten Schätzungsrichtlinien des Bayerischen Bauernverbandes für die Nutzung der streitigen Grundstücksfläche von circa 0,233 ha mit Silomais ein Jahresdeckungsbetrag von durchschnittlich 488 Euro pro Hektar ergebe, woraus sich für das Grundstück ein anteiliger Jahresbetrag in Höhe von 114 Euro errechne, der dreifach anzusetzen sei, ist unbegründet. Das Verwaltungsgericht hat den Streitwert im Ergebnis zu Recht nach § 52 Abs. 2 GKG auf 5000 Euro festgesetzt. Die erfolgte Streitwertfestsetzung auf 5000 Euro ist sowohl dann zutreffend, wenn man von der verwaltungsgerichtlichen Ansicht zum Vorliegen zweier selbstständiger Streitgegenstände ausgeht (siehe 2.1.), als auch dann, wenn man nur ein einziges Klagebegehren, nämlich die Feststellung des Nichtvorliegens eines Biotops, annimmt (siehe 2.2.).
2.1. Das Verwaltungsgericht hat die in der mündlichen Verhandlung klägerseits gestellten Anträge (1) festzustellen, dass es sich beim streitgegenständlichen Grundstück um eine Ackerfläche handelt, und (2) die Biotopkartierung ER-1263-00 vom 29. Juni 2011 hinsichtlich TF 002 (der das Grundstück betreffenden Biotopteilfläche) für kraftlos zu erklären, als zwei selbstständige Klageanträge aufgefasst und damit zwei Streitgegenstände unterschieden. Es hat die Klage im Klageantrag zu 1 so verstanden, dass damit die negative Feststellung, dass auf dem Grundstück kein gesetzlich geschütztes Biotop im Sinn des § 30 Abs. 1 BNatSchG besteht und dass der Kläger diesbezüglich nicht den Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG unterliegt, begehrt wird, und die Klage insoweit für unbegründet gehalten, weil sich auf dem Grundstück ein gesetzlich geschütztes Biotop befinde. Im Klageantrag zu 2 hat das Verwaltungsgericht die Klage dagegen für unzulässig gehalten, weil die Biotopkartierung lediglich deklaratorischen Charakter habe. Ergänzend hat es dazu ausgeführt, dass die Klage auch dann wegen des gesetzlich geschützten Biotops auf dem Grundstück erfolglos bliebe, wenn man den Klageantrag zu 2 so auslegte, dass damit im Wege einer zulässigen allgemeinen Leistungsklage die Streichung des Grundstücks aus dem Biotopverzeichnis begehrt werde. Den Streitwert, der auf § 52 Abs. 1 und 2 GKG beruhe, hat das Verwaltungsgericht auf 5000 Euro festgesetzt.
Auch bei Zugrundelegung dieser Auslegung ist trotz der beiden Klageanträge kostenrechtlich nur von einem einzigen, mit einem einzigen Streitwert zu bewertenden Streitgegenstand auszugehen, und zwar demjenigen hinsichtlich des vom Verwaltungsgericht zutreffend ausgelegten Klageantrags zu 1, weil dieser Klageantrag und der Klageantrag zu 2 denselben wirtschaftlichen Gegenstand haben, nämlich das Nichtvorliegen einer Biotopeigenschaft des streitgegenständlichen Grundstücks. Diese wirtschaftliche Identität (vgl. hierzu BVerwG, B.v. 22.09.1981 – 1 C 23.81 – BeckRS 1981, 2606) der Streitgegenstände steht der an sich nach § 39 Abs. 1 GKG vorgesehenen Streitwertaddition mehrerer Streitgegenstände entgegen.
Für den dann einzig mit einem Streitwert zu bewertenden Klageantrag zu 1 hat das Verwaltungsgericht im Ergebnis zu Recht, und zwar gemäß § 52 Abs. 2 GKG, 5000 Euro als Streitwert festgesetzt, weil der Sach- und Streitstand – entgegen der klägerischen Streitwertbeschwerde – keine genügenden Anhaltspunkte für die Bestimmung des Streitwerts nach § 52 Abs. 1 GKG bietet.
Um den Streitwert nach § 52 Abs. 1 GKG festsetzen zu können, müssen „genügende Anhaltspunkte“ für die Bestimmung des wirtschaftlichen Werts der Streitsache (des unmittelbaren Klageziels) vorhanden sein. Unabhängig davon, dass § 52 Abs. 1 GKG gegebenenfalls noch einen Ermessensspielraum einräumt, kommt diese Vorschrift von vornherein nur dann in Betracht, wenn ein unmittelbarer, begründbarer, auf hinreichenden sachlichen Faktoren beruhender Rückschluss auf den wirtschaftlichen Wert des unmittelbaren Klageziels möglich ist, der eine betragsmäßige Schätzung und nicht nur eine frei gegriffene Annahme erlaubt, sodass die Bedeutung der Sache für den Kläger in einem ziffermäßigen Geldbetrag ausgedrückt werden kann (vgl. BayVGH, B.v. 07.11.1990 – 7 C 90.2966 – NVwZ 1991, 597, B.v. 29.06.2021 – 14 C 19.2311 – juris Rn. 5).
Vorliegend fehlt es an einer solchen Rückschlussgrundlage angesichts des Grundstückszustands, der nach den dem Senat vorliegenden Akten eine reguläre landwirtschaftliche Nutzung gerade nicht gestattet, sodass es bei der Festsetzung des Auffangstreitwerts in Höhe von 5000 Euro nach § 52 Abs. 2 GKG bleibt.
Nach der Beschreibung der das klägerische Grundstück betreffenden Teilfläche ER-1263-002 aus der Biotopkartierung vom 29. Juni 2011 befinden sich dort auf einer Fläche von 0,2274 ha zu 100 % Landröhrichte; nach den aktenkundigen Unterlagen ist diese Beschreibung sowohl durch die behördlichen Feststellungen zum Grundstückszustand bei einer behördlichen Ortseinsicht am 7. November 2019 als auch durch die Angaben einer Beklagtenvertreterin in der mündlichen Verhandlung zum Grundstückszustand bei einer behördlichen Inaugenscheinnahme am 4. Oktober 2021 bestätigt worden. Auch hat der Klägerbevollmächtigte in der mündlichen Verhandlung bestätigt, dass sich auf dem streitgegenständlichen Grundstück ein Biotop entwickelt hat und dass das Grundstück größtenteils nicht regulär landwirtschaftlich nutzbar ist, weil sich darauf Röhricht befinde.
Angesichts dieser nach Aktenlage anzunehmenden Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit führen die klägerischen Erwägungen zu einer Nutzung der streitigen Grundstücksfläche mit Silomais, woraus der Kläger auf Grundlage einer von ihm als Acker angesetzten Grundstücksteilfläche von circa 0,233 ha und auf der Basis der Schätzungsrichtlinien des Bayerischen Bauernverbandes betreffend den Ertrag landwirtschaftlich nutzbarer Flächen den aus seiner Sicht zutreffenden Streitwert in Höhe von 342 Euro errechnet, nicht zu einer stichhaltigen Rückschlussgrundlage für eine Verdrängung des § 52 Abs. 2 GKG. Deshalb kann der Kläger auch nichts aus der von ihm in anderer Sache erstrittenen Rechtsprechung (BayVGH, B.v. 11.03.2004 – 9 C 03.3404 – juris) herleiten, die im damaligen Fall im Rahmen des § 13 Abs. 1 GKG a.F., einer Vorgängervorschrift des geltenden § 52 Abs. 1 GKG, von einer damals hinreichenden Grundlage für die Beurteilung der sich aus dem Klageantrag ergebenden Bedeutung der Sache für den Kläger ausgegangen ist. Vielmehr bleibt es beim Auffangstreitwert gemäß § 52 Abs. 2 GKG.
2.2. Legt man das Klagebegehren dahin aus, dass es dem Kläger allein um die Feststellung des Nichtvorliegens eines Biotops ging, wäre wegen der wirtschaftlichen Identität dieses Begehrens mit einer (zusätzlichen) Biotopverzeichnis-Streichung (siehe 2.1.) kein geringerer Streitwert festzusetzen als bei 2.1. dargestellt.
Entnommen aus den Bayerischen Verwaltungsblättern Heft 5/2024, S. 177 f.