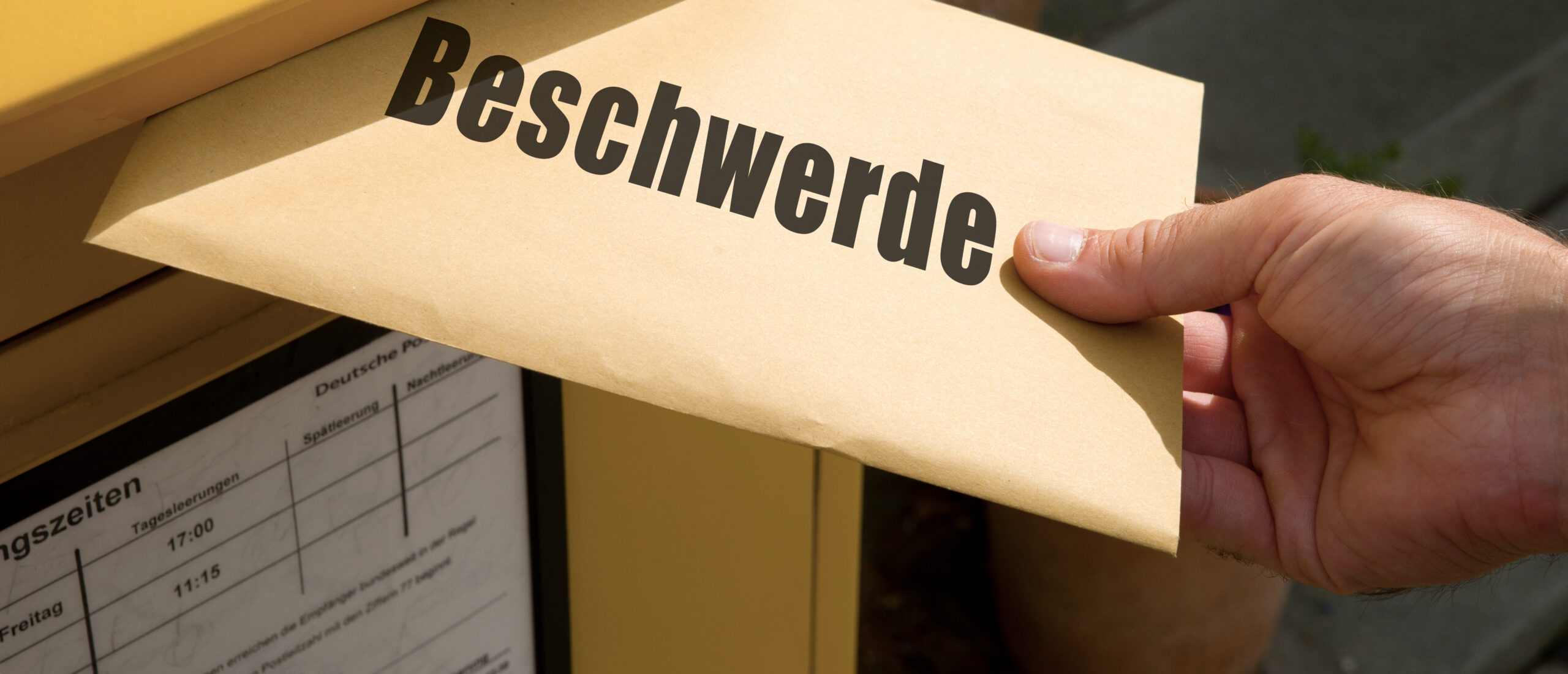Dem unten vermerkten Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) vom 7.3.2024 in einem Eilverfahren lag im Kern folgender Sachverhalt zugrunde: Der Antragsteller wandte sich gegen die Zwangsvollstreckung für rückständige Rundfunkbeiträge und Säumniszuschläge aus einem Festsetzungsbescheid. Er behauptete, dieser sei ihm nicht zugegangen; damit hatte er Erfolg. Dem Beschluss des VGH ist zu entnehmen:
-
Bekanntgabevermutung kann i.d.R. durch einfaches Bestreiten des Zugangs widerlegt werden
In dem Beschluss heißt es dazu:
„Ist die Zustellung wie hier durch Art. 23 Abs. 1 Nr. 1 VwZVG bestimmt (Art. 1 Abs. 5 VwVZG), richtet sie sich nach den Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 VwZVG). Art. 17 Abs. 1 VwZVG bestimmt, dass die Zustellung von schriftlichen Bescheiden, die – wie Festsetzungsbescheide des Antragsgegners (vgl. § 10 Abs. 5 RBStV) – bei der Heranziehung zu sonstigen öffentlichen Abgaben und Umlagen ergehen, dadurch ersetzt werden kann, dass der Bescheid dem Empfänger durch einfachen Brief verschlossen zugesandt wird. Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe nach Art. 17 Abs. 2 Satz 1 VwZVG mit dem dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass das zuzusendende Schriftstück nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Im Zweifel hat die Behörde den Zugang des Schriftstücks und den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen (Art. 17 Abs. 2 Satz 2 VwZVG).
Die Feststellung des Verwaltungsgerichts, der Antragsgegner habe keinen Nachweis dafür erbracht, dass der Festsetzungsbescheid vom 2.1.2023 dem Antragsteller zugestellt worden sei, ist auch unter Berücksichtigung des Beschwerdevorbringens nicht zu beanstanden. Entgegen der Ansicht des Antragsgegners genügt die Rüge des Antragstellers, er habe den Festsetzungsbescheid vom 2.1.2023 nicht erhalten, um die Bekanntgabevermutung des Art. 17 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 VwZVG zu widerlegen. Weder der Umstand, dass der Zeitpunkt der Aufgabe des Festsetzungsbescheids zur Post im Historiensatz des Antragsgegners vermerkt ist, noch die Tatsache, dass es keinen Postrückläufer für den Festsetzungsbescheid gegeben und der Antragsteller die sonstigen Briefe des Antragsgegners erhalten hat, rechtfertigen es, das Vorbringen des Antragstellers als Schutzbehauptung zu werten oder eine über das schlichte Bestreiten des Zugangs hinausgehende qualifizierte Darlegung von ihm zu fordern.“
-
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Widerlegung der Bekanntgabevermutung des § 41 Abs. 2 Satz 1 VwVfG
Hierzu referiert der VGH:
„Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Urteil vom 29.11.2023 – 6 C 3.22 – ausführlich mit der Frage auseinandergesetzt, wann die Bekanntgabevermutung nach § 41 Abs. 2 Satz 1 VwVfG widerlegt ist. Es hat hierzu ausgeführt, das Eingreifen der Bekanntgabevermutung gem. § 41 Abs. 2 Satz 1 VwVfG setze einen schriftlichen Verwaltungsakt voraus, der an die zutreffende Adresse des Empfängers adressiert sei und im Inland durch die Post übermittelt werde. Darüber hinaus sei erforderlich, dass der Zeitpunkt der Aufgabe zur Post als Ereignis, das den Lauf der Drei-Tage-Frist auslöse, feststehe (BVerwG, U.v. 29.11.2023 – 6 C 3.22 – juris, Rn. 22 m.w.N.).
Die Bekanntgabevermutung entfalle gem. § 41 Abs. 2 Satz 3 VwVfG, wenn der Verwaltungsakt nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen sei (Halbsatz 1); bei Zweifeln am Zugang oder seinem Zeitpunkt sei die Behörde nachweispflichtig (Halbsatz 2). Die Zweifelsregelung in § 41 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 VwVfG komme nur dann zur Anwendung, wenn nicht bereits Gewissheit über den Nichtzugang bzw. späteren Zugang bestehe. Die Frage, ob es einen Postrücklauf gebe, sei nicht erst im Rahmen der Zweifel des § 41 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 VwVfG zu würdigen; gebe es einen Postrücklauf, stehe vielmehr positiv fest, dass der Verwaltungsakt im Sinne des § 41 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 VwVfG nicht zugegangen sei. Für einen Rückgriff auf die Zweifelsregelung bestehe dann kein Raum (BVerwG, U.v. 29.11.2023 – 6 C 3.22 – juris Rn. 23 m.w.N.).
Zweifel im Sinne des § 41 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 VwVfG seien schon dann gegeben, wenn die Behörde oder das Gericht den Zugang des Verwaltungsakts für ungewiss halte. Zur Darlegung von Zweifeln genüge regelmäßig das einfache Bestreiten des Zugangs, weil einem Adressaten, der den Zugang überhaupt bestreite – anders als bei einem verspäteten Zugang – eine weitere Substantiierung typischerweise nicht möglich sei. Denn in aller Regel lägen die Umstände der Postbeförderung und -zustellung, aus denen sich Schlüsse auf den Zugang oder Nichtzugang eines mit einfacher Post versandten Bescheids ziehen ließen, außerhalb der Sphäre des Adressaten, so dass dieser aufgrund eigener Wahrnehmung nicht mehr vortragen könne als die Tatsache, den Bescheid nicht erhalten zu haben. Bestreite der Adressat den Zugang, hätten die Behörde bzw. das Gericht die Glaubhaftigkeit seines Vortrags und seine Glaubwürdigkeit zu würdigen (BVerwG, U.v. 29.11.2023 – 6 C 3.22 – juris Rn. 24 m.w.N.).
Erweise sich das Bestreiten des Zugangs unter Berücksichtigung aller Umstände des konkreten Einzelfalls als bloße Schutzbehauptung, bestünden keine Zweifel und es bleibe bei der gesetzlichen Bekanntgabevermutung. Anhaltspunkte für Schutzbehauptungen könnten sich aus der Rechtsbeziehung zwischen der Behörde und dem Adressaten ergeben, aber auch aus der Sphäre des Adressaten selbst herrühren (BVerwG, U.v. 29.11.2023 – 6 C 3.22 – juris Rn. 25 m.w.N.).
Ein qualifiziertes Bestreiten des Bescheidszugangs würde es dem Adressaten unmöglich machen, die gesetzliche Vermutung im Einzelfall zu widerlegen. Umstände wie die Dokumentation des Postausgangs und ein fehlender Rücklauf mehrerer Schreiben ermöglichten einem Adressaten weder einzeln noch in der Kombination eine über das schlichte Bestreiten des Zugangs hinausgehende Substantiierung. Darlegungslasten, die auf etwas objektiv Unmögliches gerichtet seien, dürfe es aber in einem rechtsstaatlichen Verfahren nicht geben. Überdies erschwerten derartige Substantiierungserfordernisse den Rechtsschutz des Adressaten gegen die hoheitliche Maßnahme unverhältnismäßig. Es ließen sich lediglich dann für den Adressaten ausnahmsweise weitergehende Darlegungsobliegenheiten begründen, wenn es ihm tatsächlich möglich sei, konkrete Indizien für das Fehlen eines Zugangs vorzutragen (BVerwG, U.v. 29.11.2023 – 6 C 3.22 – juris Rn. 26 m.w.N.).“
-
Übertragbarkeit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts auf die Zustellung nach dem VwZVG
Das Gericht führt dazu aus:
„Die rechtlichen Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts zu § 41 Abs. 2 Satz 3 VwVfG, die im Übrigen in einem Rundfunkbeitragsverfahren ergangen sind, sind auf den vorliegend in Bezug auf die Zustellung des Festsetzungsbescheids vom 2.1.2023 anzuwendenden und im wesentlichen gleichlautenden Art. 17 Abs. 2 VwZVG übertragbar. Die vom Antragsgegner vorgetragenen Einwände geben keinen Anlass, die Würdigung des Verwaltungsgerichts in Zweifel zu ziehen, er habe keinen Nachweis dafür erbracht, dass der Festsetzungsbescheid dem Antragsteller zugegangen ist.
Da der Festsetzungsbescheid vom 2.1.2023 ordnungsgemäß an den Antragsteller adressiert, es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Brief nicht verschlossen war, und der Zeitpunkt der Aufgabe zur Post zudem im – in den Akten des Antragsgegners befindlichen – Historiensatz vermerkt ist, sind die Voraussetzungen für das Eingreifen der Vermutungsregelung in Art. 17 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 VwZVG zwar grundsätzlich erfüllt. Anders als der Antragsgegner meint, hat das Verwaltungsgericht jedoch nachvollziehbar begründet, warum es den Vortrag des Antragstellers für glaubhaft hält, er habe den Festsetzungsbescheid vom 2.1.2023 nicht erhalten. Anhaltspunkte dafür, dass vom Antragsteller ausnahmsweise weitergehende Darlegungsobliegenheiten zu fordern wären, hat der Antragsgegner nicht vorgetragen. Dass im Mahnschreiben vom 16.2.2023 der Festsetzungsbescheid vom 2.1.2023 erwähnt ist, führt nicht zu dessen Zustellung.“
Anmerkung:
Zur Zwangsvollstreckung und zu deren Grundlagen sei auf folgenden im Richard Boorberg Verlag erschienenen Titel hingewiesen: Formularleitfaden für die kommunale Vollstreckungsbehörde, Ausgabe Bayern, von Kretschmer/Heyner. Näheres unter www.boorberg.de.
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 7.3.2024 – 7 CE 23.1749
Beitrag entnommen aus Gemeindekasse Bayern 10/2025, Rn. 84.