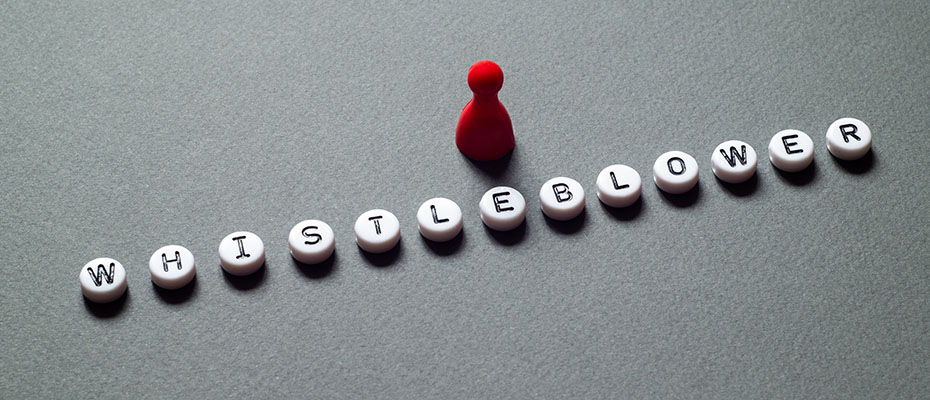Dem unten vermerkten Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) vom 21.6.2023 lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Mit Bescheid des Beklagten vom 1.4.2022 wurde die bereits am 18.3.2022 fernmündlich angeordnete und durchgeführte Fortnahme und anderweitige pflegliche Unterbringung von sechs Turmfalken, einer Schleiereule und dreier Uhus auf Kosten des Klägers schriftlich bestätigt und der Kläger zur weiteren Duldung dieser Maßnahmen verpflichtet. Das Verwaltungsgericht (VG) hat die hiergegen gerichtete Klage abgewiesen. Zur Begründung hat das VG ausgeführt, der Kläger sei als Vorsitzender eines Tierschutzvereins, der die Vögel als herrenlose Wildtiere in Obhut genommen habe, Halter dieser Tiere, da er sie auf seinem Grundstück betreut habe. Die Voraussetzungen für die Fortnahme und anderweitige Unterbringung der Tiere gemäß § 16a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 i.V.m. § 2 Tierschutzgesetz (TierSchG) hätten im maßgeblichen Zeitpunkt des Bescheiderlasses vorgelegen, weil die Tiere erheblich vernachlässigt gewesen seien.
Der VGH lehnte die vom Kläger beantragte Zulassung der Berufung ab. Dem Beschluss des VGH entnehmen wir Folgendes:
1. Tierhalter als richtiger Adressat des Fortnahmebescheids
„Der Kläger macht zunächst geltend, er sei nur hinsichtlich der Uhus der richtige Adressat des streitgegenständlichen Bescheids, da Halter der übrigen Tiere der Verein sei. Selbst wenn man mit dem Verwaltungsgericht davon ausgehen wolle, dass der Kläger neben dem Verein als Mithalter anzusehen sei, da er die Betreuung der Tiere übernommen habe, hätte zumindest auch gegen den Verein ein Wegnahmebescheid ergehen müssen. Dass die Behörde dies bis heute unterlassen habe, führe zur Rechtswidrigkeit des streitgegenständlichen Bescheids.
Damit dringt der Kläger nicht durch. Dass er neben den Uhus, deren Eigentümer er ist, als erster Vorsitzender des Tierschutzvereins auch die anderen Tiere betreute bzw. zu betreuen hatte, stellt er selbst nicht in Abrede; damit ist er aber als Halter der Tiere anzusehen (Hirt/Maisack/Moritz/Felde, Tierschutzgesetz, 4. Auflage 2023, § 16a Rn. 21 m.w.N.). Auf die Frage, ob der Kläger auch Eigentümer der Tiere ist oder ob neben ihm noch weitere Personen als Halter der Tiere anzusehen waren, kommt es für die Rechtmäßigkeit der an ihn gerichteten Fortnahmeverfügung nicht an. Die konkrete Möglichkeit, dass ein Dritter, insbesondere der Verein, Eigentümer der in Obhut genommenen Wildtiere sein könnte, sodass mangels einer diesem gegenüber ergangenen Duldungsverfügung hinsichtlich des streitgegenständlichen Bescheids (allenfalls) ein Vollstreckungshindernis anzunehmen sein könnte (vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 7.8.2008 – 7 C 7.08 – NVwZ 2009, 120, Rn. 25; Hirt/Maisack/Moritz/Felde, a.a.O., § 16a Rn. 38 m.w.N.), ist weder dargelegt noch ersichtlich.“
2. Die Einstellung eines Strafverfahrens hindert die auf § 16 TierSchG gestützte Anordnung der Fortnahme von Tieren nicht
„Entgegen der Auffassung des Klägers ergibt sich aus der … Einstellung des gegen ihn geführten Strafverfahrens wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz nicht, dass die Voraussetzungen des § 16a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 TierSchG nicht vorlagen.
Zum einen entfaltet die Einstellung eines strafrechtlichen Verfahrens im Sicherheitsrecht, zu dem auch § 16a TierSchG zählt, im Grundsatz keine Bindungswirkung, da dieses gegenüber dem Strafrecht eine andere Zielsetzung verfolgt. Im Sicherheitsrecht geht es nicht um die repressive Ahndung strafbaren Unrechts, sondern um präventive Gefahrenabwehr. Eine Bindungswirkung der Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichte an die strafgerichtliche Beurteilung eines Sachverhalts ist im Tierschutzrecht – anders als etwa im Fahrerlaubnisrecht (vgl. § 3 Abs. 4 StVG) – auch im Fall einer rechtskräftigen strafgerichtlichen Entscheidung gesetzlich gerade nicht angeordnet, sodass Behörden und Verwaltungsgerichte stets eine eigenständige Beurteilung hinsichtlich des Vorliegens der Voraussetzungen für den Erlass tierschutzrechtlicher Anordnungen nach § 16a Abs. 1 TierSchG vorzunehmen haben.
Die Einstellung eines Strafverfahrens kann zudem aus vielerlei Gründen erfolgen, unter anderem aus prozessualen Gründen, wegen des Grundsatzes ,in dubio pro reo‘ (§ 170 Abs. 2 StPO) oder weil das öffentliche Interesse eine Strafverfolgung nicht erfordert (§ 153 ff. StPO); derartige Voraussetzungen sind dem Sicherheitsrecht jedoch fremd. Die Einstellung des Strafverfahrens steht daher – ebenso wenig wie ein Freispruch – der Berücksichtigung eines Sachverhalts im Rahmen einer tierschutzrechtlichen Maßnahme jedenfalls dann nicht entgegen, wenn sie nicht wegen erwiesener Nichterfüllung des objektiven Tatbestands erfolgt (vgl. BayVGH, Urteil vom 20.3.2001 – 24 B 99.2709 – juris Rn. 44). Dass vorliegend das Strafverfahren gegen den Kläger nach Einlegung des Einspruchs gegen den zunächst ergangenen Strafbefehl wegen erwiesener Nichterfüllung des strafrechtlichen Tatbestands erfolgt ist, ist weder vorgetragen noch ersichtlich. Vielmehr hat der Beklagte – von Klägerseite unwidersprochen – ausgeführt, dass das Strafverfahren gegen Zahlung einer Geldauflage gemäß § 153a StPO eingestellt wurde …; eine Einstellung nach § 153a StPO setzt aber grundsätzlich einen weiterhin bestehenden hinreichenden Tatverdacht voraus … Schließlich erfordert § 16a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 TierSchG – anders als die strafrechtliche Norm des § 17 Nr. 2 TierSchG – nicht, dass es bereits zu erheblichen Schmerzen oder Leiden bei den Tieren gekommen ist. Vielmehr ist die in ersterer Vorschrift vorausgesetzte erhebliche Vernachlässigung bereits dann anzunehmen, wenn einzelne Anforderungen aus § 2 TierSchG für einen längeren Zeitraum und/oder in besonders intensiver Form verletzt worden sind und hierdurch für das Tier die Gefahr von Leiden, Schmerzen oder Schäden droht (Hirt/Maisack/Moritz/Felde, a.a.O., § 16a Rn. 22); auf die Gründe der Vernachlässigung oder ein Verschulden kommt es hierbei nicht an (Lorz/Metzger, TierSchG, 7. Auflage 2019, § 16a Rn. 20).“
[…]Den vollständigen Beitrag lesen Sie in der Fundstelle Bayern Heft 5/2024, Rn. 55.