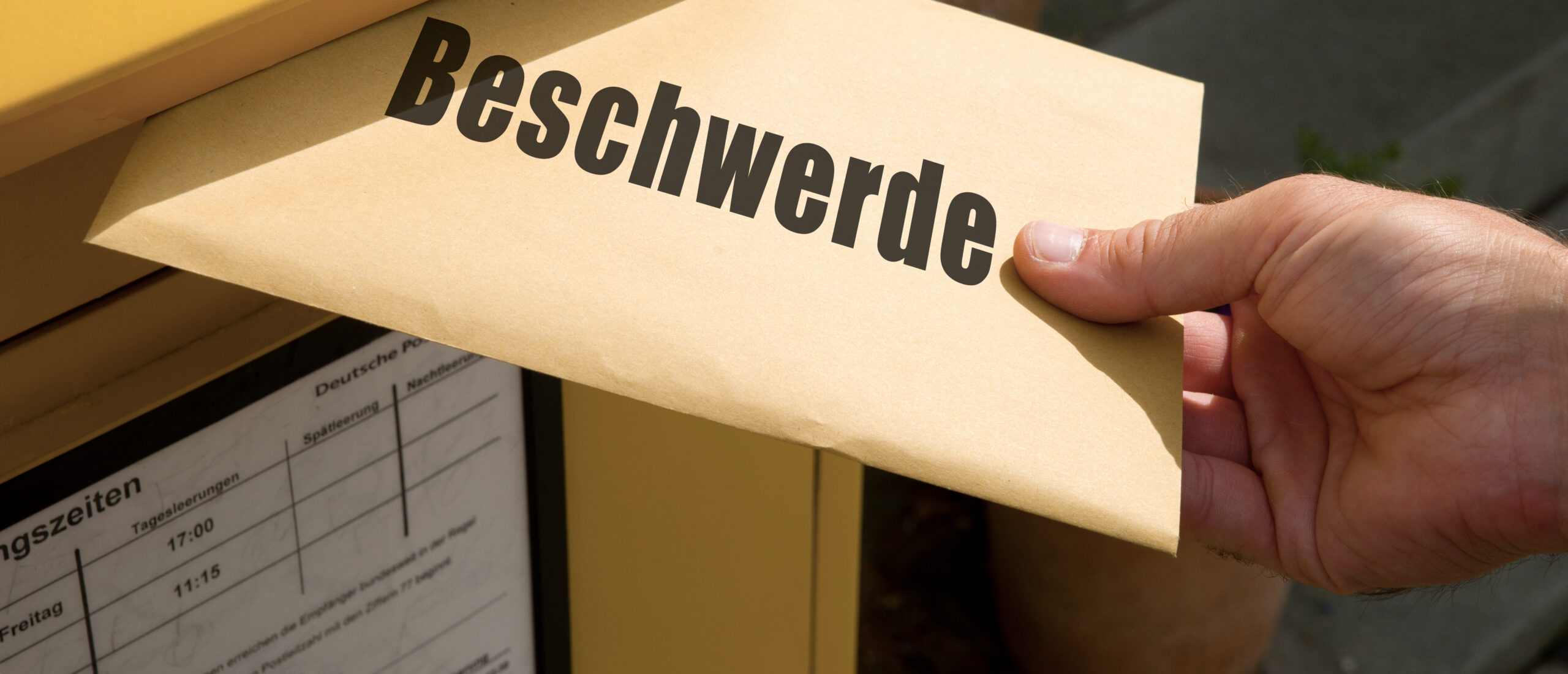Im Kampf gegen unterschiedliche Kriminalitätsphänomene sieht sich die Polizei immer größer und komplexer werdenden Datenmengen ausgesetzt, welche durch manuelle Auswertung kaum noch zu bewältigen sind. Abhilfe sollen hier moderne und digitale Ermittlungsinstrumente wie das verfahrensübergreifende Analysesystem VeRA leisten. Der bayerische Gesetzgeber hat hierfür jüngst im Einklang mit den Wertungen des BVerfG aus dem Urteil vom 16. Februar 2023 eine eigenständige und spezifische Ermächtigungsgrundlage geschaffen. Der nachfolgende Beitrag soll diese Norm aus sicherheitsverfassungsrechtlicher Perspektive beleuchten.
I. Ausgangslage
Die polizeiliche Ermittlungstätigkeit wird vor die Herausforderung gestellt, dass sich bekannte Kriminalitätsphänomene verändern und immer stärker in digitale Räume verlagern. Die voranschreitende Digitalisierung betrifft damit auch Kriminalität. Gleichzeitig werden diese Kriminalitätsphänomene immer komplexer und die im Rahmen der Ermittlungstätigkeit angefallenen Datenmengen immer größer: „Der „polizeiliche Handwerkskasten“ wirkt dieser enormen Herausforderung gegenüber anachronistisch und eher wie ein „Erste-Hilfe-Set“.1 Zwar hat die Polizei in ihren Wissensbeständen in Summe ein enormes Informationsvolumen über eine Vielzahl von Betroffenen. So sind im Bayerischen Vorgangsbearbeitungssystem IGVP Ende August 2022 rund 38,7 Millionen Personen erfasst worden2. Auch bewirkt das verfassungsgerichtlich legitimierte Institut der Zweckänderung3 die grundsätzliche Möglichkeit der Nutzung von Daten aus der Strafverfolgung für Zwecke der Gefahrenabwehr und andersherum. Die Informationsgewinnungsmöglichkeiten werden durch immer neuere Erhebungsinstrumente stetig ausgeweitet. Die Probleme liegen jedoch häufig in der zweiten, an die Datengewinnung anschließende Ebene: Der Informationsordnung4. Denn die historisch gewachsene extrem heterogene und fragmentierte IT-Infrastruktur bewirkt, dass diese Informationen in einer Vielzahl unterschiedlicher Systeme vorhanden sind und mühsam einzeln abgefragt und in polizeilicher Handarbeit zusammengetragen werden müssen. Dies führt dazu, dass die Polizei bei der Wissensgenerierung ihrem Äquivalent in Form potenzieller Gefährder und Straftäter zeitlich hinterherhinkt: „Die Polizei weiß erst nach Tagen, was die Polizei weiß“5.
II. Die verfahrensübergreifende Analyseplattform als kontroverses Lösungsmittel
Dieser defizitären Situation soll in Bayern durch ein Analysetool zur datenbankübergreifenden Recherche abgeholfen werden. Dieses Tool ist dazu konzipiert, die polizeiliche Entscheidungsfindung durch die algorithmische Verarbeitung großer Datenmengen zu verbessern und zu beschleunigen6. Dieses verfahrensübergreifenden Recherche- und Analysesystem (VeRA) basiert, wie auch das hessische Pendant „hessenDATA“, auf der Software „Gotham“ des US-amerikanischen Softwareunternehmens Palantir7, welcher bereits in den USA für diverse große Strafverfolgungsbehörden ähnliche Tools zur Verfügung stellt8. Diese soll Informationen aus unterschiedlichen Datenbanken analysieren und datenbankübergreifend vernetzen, um so neuartige Erkenntnisse und Sachzusammenhänge aufzudecken. Gotham strebt damit eine „Entsilosierung“ 9 polizeilicher Datenbestände an. Die Software verlinkt die Informationen aus den unterschiedlichen Systemen miteinander und stellt die Verknüpfungen grafisch dar10.Während früher etwa die Halterabfrage eines Kennzeichens beim Kraftfahrtbundesamt, die Übersicht der Vorstrafen und die Beziehung zu anderen polizeilich relevanten Personen mühselig in unterschiedlichen Systemen abgefragt werden musste, kann dies nunmehr automatisiert durch eine zentrale Software geschehen. Diese „Link-Analysis“11 kann gerade bei zeitkritischen Ermittlungen12 oder komplex-vernetzten Organisationsstrukturen wie in der organisierten Kriminalität oder dem islamistischen Terrorismus von Gewinn sein13.
Diesen enormen Vorteilen und Chancen stehen freilich gewichtige Risiken gegenüber. So haben diese Recherche- und Analysetools einen gewaltigen „Datenhunger“. Sie können umso mehr Ergebnisse produzieren und Zusammenhänge aufdecken, je größer der Dateneintrag ist. So beschrieb ein Mitarbeiter des LAPD in der Studie von Brayne die Herangehensweise wie folgt:
„Maybe we shouldn’t collect this information. Maybe we shouldn’t add consumer information. Maybe we shouldn’t get everybody’s Twitter feed in … All we’re doing right now is, ‚Let’s just collect more and more and more data and something good will just happen.‘ And that’s I think that’s kind of wishful thinking14.“
Nicht nur steigt damit der „Überwachungsdruck“ auf die jeweilige betroffene Person signifikant an, es werden auch immer mehr unbeteiligte Personen zum Ziel dieser Datenanalyse. Denn in den Vorgangsbearbeitungssystemen sind auch solche Personen gespeichert, die nicht unmittelbar Täter, Verdächtige oder Störer sind oder waren, sondern etwa auch Zeugen, Hinweisgeber oder Ähnliches15. Auch diese können durch die softwaregestützte Auswertung in den Fokus polizeilicher Ermittlungen geraten. Ferner werden automatisierte Datenanalysen auch immer wieder mit einem erhöhten Diskriminierungsrisiko assoziiert. Der bereits in den Datenansätzen angelegte und durch die Weiterverarbeitung manifestierte Bias zuungunsten ethnischer Minderheiten werde so verstärkt16. Hinzu komme ein intransparenter Entwicklungsprozess, welcher diskriminierende Algorithmen nicht hinreichend sicher ausschließe17.
III. Die Einführung von VeRA in Bayern
Die Einführung von VeRA in der bayerischen Landespolizei war von schwierigen Umständen begleitet.
1. Testung ohne spezifische Rechtsgrundlage
Der Plan, ein verfahrensübergreifendes Analysetool zu nutzen, bestand offenbar schon seit einigen Jahren. Im März 2022 wurde laut Pressemitteilung des Landeskriminalamtes der Zuschlag an das Unternehmen Palantir erteilt. Ende 2023 ergaben Recherchen des Bayerischen Rundfunks, dass das dortige LKA die Software bereits seit einiger Zeit mit echten Personendaten aus den dortigen Datenbeständen testet. Zu diesem Zeitpunkt hatte Bayern noch keine spezifische Rechtsgrundlage geschaffen. Das für Inneres zuständige Staatsministerium sah das Vorgehen durch das Landesdatenschutzgesetz gedeckt, was der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz jedoch bezweifelte. Besonders pikant an dieser Situation war der Umstand, dass der zuständige Landesbeauftragte seiner eigenen Aussage zufolge erst durch die Recherchen des Bayerischen Rundfunks vom Testeinsatz der Software erfahren habe18. Zwar wurde ihm bereits 2019 von dem Vorhaben berichtet19, über den exakten Verlauf und insbesondere die Tatsache der bereits angelaufenen Testung mit Echtdaten sei er jedoch nicht informiert worden20. In der Folge untersagte er den Testbetrieb in der damaligen Form21, sodass das bayerische LKA in der Folge nur noch mit pseudonymisierten Daten arbeitete22. Auf eine kleine Anfrage erklärte das zuständige Staatsministerium, dass dem Landesdatenschutzbeauftragten im März 2023 in einem mündlichen Gespräch mit dem Leiter des dortigen LKA-Leiters von dem Vorhaben berichtet worden sei, dieser jedoch keine weiteren Unterlagen anforderte. Ferner führte das Staatsministerium aus, dass zwar eine Testung mit Echtdaten stattfand, diese jedoch nur der Anbindung und Datenintegration der unterschiedlichen Quellsysteme gedient habe: eine verfahrensübergreifende Recherche habe nicht stattgefunden23.
Dieses Vorkommnis ist in der Bundesrepublik bei Weitem nicht einzigartig. Erst vor einigen Monaten wurde bekannt, dass das BKA seine Gesichtserkennungssoftware mit Echtdaten aus INPOL, dem Verbundsystem der Landes- und Bundespolizeibehörden fütterte24.
2. Lösung durch PAG-Novelle
Die „nachgeschobene“ Rechtsgrundlage kam schließlich mit dem Gesetzentwurf vom 9. April 2024. Neben einigen Anpassungen an die BVerfG-Judikatur zum SOG M-V25 sollte hier in Form von Art. 61a PAG auch eine Rechtsgrundlage für die mit VeRA assoziierten Grundrechtseingriffe durch Weiterverarbeitung geschaffen werden. Die Sachverständigenanhörung im Innenausschuss zeichnete ein heterogenes Bild: Die Einschätzungen reichten von „sachgerecht“ (Markus Thiel, DPolH) und der Notwendigkeit „digitale[r] Chancengleichheit mit den Kriminellen“ (Günther Gietl, Polizeipräsident) bis hin zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit (Mark A. Zöller, LMU) und der Kritik an der „Überprüfung von Millionen unbescholtener Bürger“ (Thomas Petri, BayLfDI)26.
Der Bayerische Landtag beschloss den Gesetzentwurf schließlich in seiner Sitzung vom 17. Juli 2024: Er trat zum 1. August 2024 in Kraft.
[…]1 Für diesen treffenden Vergleich s. Dirk Peglow für den Bund Deutscher Kriminalbeamter, Stellungnahme zum Antrag der Fraktion CDU/CSU Handlungsfähigkeit der Strafverfolgungsbehörden sichern – Entscheidung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat bezüglich der polizeilichen Analyse-Software Bundes-VeRA revidieren, Ausschussdrucksache 20(4)418 I S. 2.
2 Koch, Bayern stimmt für Polizeisoftware VeRA und wünscht viel Spaß mit „Bundes-VeRA“, Stand: 17.07.2024.
3 Vgl. zu den Anforderungen BVerfGE 141, 220 Rn. 287 ff.
4 Dazu jüngst ausführlich Golla, Die kriminalbehördliche Informationsordnung, 2024, abrufbar unter https://digitalrecht-oe.uni-trier.de/index.php/ droe/catalog/view/10/11/63.
5 Zum ganzen Klaus Teufele, LKA Bayern, Ausschussdrucksache 20(4)418 I B S. 2.
6 Egbert/Esposito/Heimstädt, Vorhersagen und Entscheiden: Predictive Policing in Polizeiorganisationen, Soziale Systeme 2021, 189.
7 Bayerisches Landeskriminalamt, Projekt VeRA: Ergebnis der Quellcodeüberprüfung, PM v. 08.03.2023.
8 Vgl. bei Brayne, Big Data Surveillance The Case of Policing. American Sociological; Review, 2017, 977 (987).
9 Egbert, Datafizierte Polizeiarbeit – (Wissens-)praktische Implikationen und rechtliche Herausforderungen in: Hunold/Rauch (Hrsg.), Polizeiarbeit zwischen Praxishandeln und Rechtsordnung, 2020, S. 77 (85).
10 Zur Funktionsweise der Software vgl. ausführlich Brayne (Fn. 8).
11 Sommerer, Personenbezogenes Predictive Policing, 2019, S. 90 f.
12 Für ein Beispiel eines kurz bevorstehenden Anschlages in Eschwege Hessischer Landtag, LT-Drs. 19/6864 S. 18.
13 Vgl. Kugelmann/Buchmann, Der Algorithmus und die Künstliche Intelligenz als Ermittler, GSZ 2024, 1/3.
14 Brayne (Fn. 8), 996.
15 Petri, Urteilsanmerkungen, ZD 2023, 338/345 führt als plakatives Beispiel den „ehrlichen Finder“ an, der ebenfalls Teil polizeilicher Datenbestände wird.
16 Vgl. ausführlich bei Browning/Arrigo, Stop and Risk: Policing, Data, and the Digital Age of Discrimination, American journal of Criminal Justice, 2021, 298/299 ff.
17 Ruf (Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V.), Ausschussdrucksache 20(4)418 D S. 5 f.
18 Kartheuser et al., Umstrittene Polizeisoftware: Testet Bayern ohne Rechtsgrundlage?, Bayerischer Rundfunk v. 30.11.2023, abrufbar unter www.br.de/nachrichten/bayern/umstrittene-polizeisoftware-testet-bayern-ohne-rechtsgrundlage,Tx1Ylla.
19 BayLfDI, 32. Tätigkeitsbericht 2022, Ziffer 3.1.
20 Kartheuser et al., Umstrittene Polizeisoftware: Testet Bayern ohne Rechtsgrundlage?, Bayerischer Rundfunk v. 30.11.2023, abrufbar unter www.br.de/nachrichten/bayern/umstrittene-polizeisoftware-testet-bayern-ohne-rechtsgrundlage,Tx1Ylla.
21 Meyer-Fünffinger et al., Palantir-Software: Bayerisches LKA soll Testbetrieb stoppen, Bayerischer Rundfunk v. 26.01.2024, abrufbar unter www.br.de/nachrichten/bayern/palantir-software-bayerisches-lka-soll-testbetriebstoppen,U2OTyOI.
22 Koch, Bayern stimmt für Polizeisoftware VeRA und wünscht viel Spaß mit „Bundes-Vera“, Heise-online v. 17.07.2024, abrufbar unter www.heise.de/news/Bayerische-Landtag-stimmt-ueber-Einsatz-der-Polizeisoftware-VeRA-von-Palantir-ab-9803176.html.
23 LT-Drs. 119/18 S. 1 – 3.
24 Ciesielski/Zierer, Fragwürdiger Test: BKA nutzte Polizeifotos für Software- Test, Bayerischer Rundfunk v. 10.05.2024. www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/fragwuerdiger-test-bka-nutzte-millionen-gesichtsbilder,UCCBX4X.
25 BVerfGE 165, 1 ff.
26 Lohmann, Zusammenfassung der Sachverständigenanhörung v. 16.05.2024, abrufbar unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/aus-den-ausschuessen/innenausschuss-anhoerung-zum-gesetzentwurf-zur-aenderung-des-polizeiaufgabengesetzes-und-weiterer-rechtsvorschriften/.
[…]Den vollständigen Beitrag lesen Sie in Bayerische Verwaltungsblätter 02/2025, S. 44.